Der BDEx (Bundesverband des Deutschen Exporthandels e.V.) fungiert als führender Verband für deutsche Unternehmen im Außenhandel. Seine vorrangige Aufgabe besteht darin, die gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder im Exporthandel zu schützen und zu fördern, indem er sich gezielt für deren Belange im internationalen Handel einsetzt.
Beraten.
Länder- und Marktinformationen 6/2025
Afrika
ÄGYPTEN / BAUWIRTSCHAFT: Hochbau: Nachhaltiges Bauen und Energieeffizienz
Energieeffizientes Bauen steht in Ägypten noch am Anfang. Ein vereinfachtes Zertifizierungssystem kann bei der Umsetzung in mehr Projekten helfen.
Wohngebäude sind der mit Abstand größte Stromverbraucher in Ägypten. Nach Angaben der Egyptian Electricity Holding Company für das Finanzjahr 2022/2023 stand dieser Bereich für 46 Prozent der gesamten verkauften Elektrizität. Damit besitzt er auch ein überragendes Einsparpotenzial. Ein erheblicher Teil des Verbrauchs geht auf den Einsatz von Klimaanlagen zurück. Mit heißeren und längeren Sommern im Zuge des globalen Klimawandels wird dieser Aspekt tendenziell weiter an Bedeutung gewinnen. Große Neubauprojekte geben Gelegenheit, die Energieeffizienz zu verbessern.
Vor- und Nachteile der bestehenden Gebäudestruktur
Fast die gesamte Bevölkerung Ägyptens konzentriert sich in den traditionellen Siedlungsräumen des Niltals und des Nildeltas. Abgesehen von einigen Oasen kann nur dort Landwirtschaft ohne erheblichen Aufwand für künstliche Bewässerung betrieben werden. Das Land wird entsprechend intensiv genutzt. Dörfer und Städte sind in der Regel sehr dicht gebaut, um möglichst wenig der wertvollen Anbaufläche zu verlieren. Es dominiert daher eine kompakte Bauweise, in den Städten fast ausschließlich im Geschosswohnungsbau.
Allerdings ist ein beträchtlicher Teil der Wohngebäude in informeller Weise errichtet, und wird zum Teil nach und nach um Stockwerke erweitert, wenn Geld zur Verfügung steht. Diese Gebäude sind technisch sehr einfach gebaut, etwa was Beleuchtung oder Wasserversorgung angeht. Aufgrund der in der Vergangenheit erheblichen Subventionen auf den Energiepreis bestand wenig Anreiz zu energieeffizientem Bauen. Auch fehlt meistens das Bewusstsein und das Wissen hierzu. Fortschritte lassen sich eventuell mittelfristig durch den Ersatz von Geräten (Klimaanlagen) oder den Einbau von Verbrauchsreglern (Smart Meter) erreichen.
Anders sieht es bei den Gebäuden in den neu geplanten Entlastungsstädten wie New Cairo aus. Sie werden komplett in der Wüste errichtet. Da die Nutzungskonkurrenz mit der Landwirtschaft keine Rolle spielt, ist der Anteil von Villen und Einfamilienhäusern hier größer. Auch Geschosswohnungen weisen oft größere Flächen auf. Die Immobilienpreise liegen hier höher als in den meisten Vierteln des alten Kairo. Effizienzkriterien können bei den Neubauten von Beginn an berücksichtigt werden. Höhere Investitionen in die Bauausführung oder die Ausstattung können eher im Miet- oder Verkaufspreis abgebildet werden.
Welche Zertifizierung passt?
Um einen höheren Preis beim Verkauf oder der Vermietung zu erzielen, kann es hilfreich sein, das Gebäude nach einem anerkannten Standard als energieeffizient zertifizieren zu lassen. International gibt es eine Vielzahl von Zertifikaten, die sich an den Bedingungen im jeweiligen Herkunftsland orientieren und in der Zahl der betrachteten Variablen sowie ihrer Gewichtung voneinander abweichen. Verbreitet sind etwa der britische Standard BREEAM, der US-amerikanische Standard LEED oder EDGE von der Weltbank-Gruppe. Verpflichtend ist eine Zertifizierung nicht.
Ägypten hat sich 2005 den ersten Building Energy Efficiency Code (ECP 306-2005) gegeben. Formuliert hat ihn das Egyptian Housing and Building National Research Center (HBRC). Auf Basis von LEED hat das HBRC dann bis 2011 das Green Pyramid Rating System (GPRS) entwickelt. Einen alternativen Standard für nachhaltiges Bauen hat das Egypt Green Building Council (EGBC) entworfen. Das Tarsheed genannte Regelwerk orientiert sich am Standard EDGE und betrachtet mit den Kategorien Wasser, Energie und Gebäudequalität lediglich drei Bereiche. Gefordert wird dann jeweils eine Verbesserung um mindestens 20 Prozent gegenüber von Basiswerten.
Während nach den von EDGE publizierten Zahlen die Standards LEED und EDGE in Ägypten bisher am meisten verwendet worden sind, zeigt die Aufstellung außerdem, dass diese Zertifizierungen sich ausschließlich auf Gewerbebauten beschränken. GPRS und Tarsheed wurden dagegen zumindest zu einem geringen Prozentsatz auch bereits auf Wohngebäude angewendet. Unabhängige Untersuchungen weisen darauf hin, dass Inhalte zum nachhaltigen Bauen erst langsam in die Lehrpläne der Universitäten Eingang finden und viele der aktiven Architekten nur Teilkenntnisse in diesem Bereich aufweisen. Ein weniger umfangreicher Standard wie Tarsheed könnte hier die Anwendung schneller ausweiten.
Wenig Geld für Förderung
Es gibt keine direkten Förderprogramme für nachhaltiges Bauen in Ägypten. Speziell im Energiebereich sind aber einzelne Regelungen anwendbar, die zu einer Verbesserung der Gebäudebilanz führen können. Dies sind etwa ein Tarif zur Einspeisung von aus Abfällen erzeugter Elektrizität oder die 2023 erweiterten Möglichkeiten zum Einsatz kleiner Solaranlagen und deren Anschluss an das nationale Stromnetz.
Auch ägyptische Banken haben nach Angaben von EDGE bisher keine speziellen Finanzierungsprodukte für nachhaltiges Bauen im Angebot. Wohl aber besteht über einzelne lokale Banken die Möglichkeit, auf geförderte Finanzierungen internationaler Institutionen zuzugreifen. Genannt werden hier die Green Economy Finance Facility des Green Climate Fund (GCF) und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) sowie der Market Accelerator for Green Construction (MAGC) der International Finance Corporation (Weltbank-Gruppe).
ÄGYPTEN / MARKT: Konjunktur in Ägypten zieht deutlich an
Ägyptens Wirtschaft befindet sich im Aufwind: Investitionen in Infrastruktur und Produktion sowie eine sinkende Inflation sollen einen kräftigen Schub bringen.
Top-Thema: Investitionen in Infrastruktur und Produktion angekündigt
Auch wenn die Verwirklichung der Vorhaben nicht immer sicher ist: Die Vielzahl von Ankündigungen von Investitionen in die Infrastruktur, in Produktionsbetriebe und neue Siedlungen hellen die Aussichten für die ägyptische Konjunktur auf. So erwartet die Economist Intelligence Unit (EIU) 2026 einen Anstieg der Bruttoanlageinvestitionen in Ägypten um real 17 Prozent. Und dieses Plus soll in den Folgejahren zweistellig bleiben.
Neben den zahlreichen Verkehrsprojekten wie Metro- und Eisenbahnstrecken und dem geplanten raschen Ausbau der erneuerbaren Energien sind es auch Investitionen in industrielle Produktionsanlagen, die zu der Zunahme beitragen. Ein wesentlicher Faktor: Nach der Abwertung des ägyptischen Pfundes und der Freigabe des Wechselkurses im März 2024 hat sich die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes verbessert. Insbesondere Unternehmen der Textilindustrie und der Nahrungsmittelverarbeitung haben den Ausbau bestehender oder die Errichtung neuer Betriebe angekündigt. Viele Investoren kommen aus der Türkei oder aus China.
Die Bedienung des einheimischen Markts, aber auch von Kunden in anderen afrikanischen Ländern und in Europa ist ein Motiv vor allem für chinesische Automobilhersteller, über eine Produktion in Ägypten nachzudenken. Am Beginn steht allerdings meist die reine Montage, mit überschaubaren Stückzahlen. Ob die von den USA weltweit angedrohten Zölle einen Effekt auf die Industrieansiedlung haben, bleibt abzuwarten. In Ägypten, das in den Ankündigungen lediglich mit dem Basissatz von 10 Prozent belegt wurde, sehen Kommentatoren einen Vorteil gegenüber asiatischen Wettbewerbern, für die erheblich höhere Sätze gelten sollen.
Wirtschaftsentwicklung: Wachstum zieht an
Übereinstimmend sehen die Prognosen von Internationalem Währungsfonds (IWF), Entwicklungsbanken und Wirtschaftsinstituten wie der EIU eine schnellere reale Zunahme des Bruttoinlandsproduktes (BIP) in den nächsten Jahren. Für 2025 geht der IWF von einem Wachstum von 3,8 Prozent aus, das sich 2026 auf 4,1 Prozent beschleunigen soll. Die EIU erwartet lediglich 3,2 Prozent für 2026, aber deutlich über 5 Prozent ab 2026.
Deutlich gesunken ist seit Jahresbeginn 2025 die Inflationsrate. Lag sie 2024 noch bei annähernd 30 Prozent, verzeichnet die ägyptische Zentralbank im März 2025 einen jährlichen Preisanstieg von nur noch 13,6 Prozent. Ein weiteres Absinken auf einstellige Werte wird bis 2026 erwartet. Damit entspannt sich die Lage für die ägyptischen Konsumenten. Geholfen haben ihnen auch die Überweisungen von Auslandsägyptern. Im Jahr 2024 stiegen diese um 51,3 Prozent auf 29,6 Milliarden US-Dollar (US$). Der Trend in den ersten Monaten 2025 weist weiter nach oben.
Noch nicht erholt haben sich die Einnahmen aus dem Suezkanal. Mit circa 13.000 passierten 2024 nur halb so viele Schiffe die Wasserstraße wie im Vorjahr. Die eingenommenen Durchfahrtsgebühren sanken von 10,25 Milliarden US$ 2023 auf nur noch 3,9 Milliarden US$. Positive Impulse kamen dagegen aus dem Tourismus. Die Zahl der Besucher stieg trotz der Konflikte in der Region 2024 um 5,4 Prozent auf 15,7 Millionen.

Haushaltskonsolidierung schwierig
Mit 8 Milliarden US$, ausgezahlt in mehreren Tranchen, unterstützt der IWF Ägypten derzeit im Rahmen einer Extended Fund Faciility. Diese EFF ist mit Auflagen verbunden, insbesondere der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte. Ein wesentliches Element dabei ist die Privatisierung staatlicher Unternehmen, wie sie derzeit bei den Flughäfen angegangen wird. Bei den oft stark verflochtenen Produktionsbetrieben mit staatlicher Beteiligung gestaltet sich die Umsetzung schwieriger. Analysten erwarten hier nur langsame Fortschritte.
Auch der geforderte Abbau von Subventionen, etwa für Treibstoffe und Grundnahrungsmittel, stößt auf Hindernisse. Hiervon wären weite Bevölkerungsteile betroffen, was erhebliche soziale Härten zur Folge hätte und politisch schwer durchzusetzen ist. Alternativ versucht die Regierung nun, die Steuereinnahmen zu erhöhen, und zwar durch eine effizientere Erhebung und den Abbau von Steuervergünstigungen. Hier ist ebenfalls behutsames Vorgehen angesagt, um das derzeit eher günstige Investitionsklima nicht zu beschädigen.
Handelsbilanz bleibt im Defizit
Weil Ägypten einen Teil der benötigten Energierohstoffe, vor allem Flüssiggas, derzeit importieren muss, steigen die Einfuhren schneller als die Exporte. Auch der Import von Investitionsgütern trägt zum weiterhin hohen Defizit in der Handelsbilanz bei. Geldzuflüsse aus dem Ausland müssen diese Lücke schließen, sei es im Rahmen internationaler Unterstützung, durch Überweisungen von Auslandsägyptern, ausländische Direktinvestitionen oder Dienstleistungsexporte Ägyptens, vor allem im Tourismus.
An der Spitze der ägyptischen Importe nach Warengruppen stehen neben mineralischen Brennstoffen Maschinen, Anlagen, elektrische Ausrüstungen und Geräte sowie Fahrzeuge und Kunststoffe. Wichtigste Lieferländer waren 2024 China mit einem Anteil von 16,4 Prozent, Saudi-Arabien (8,4 Prozent), die USA (8,0 Prozent), Russland (6,3 Prozent) und Deutschland (4,6 Prozent). Bei Ägyptens Exporten stehen Öl und Gas an der Spitze. Danach folgen Produkte der Elektroindustrie, Düngemittel, Obst und Nüsse sowie Eisen und Stahl. Wichtigste Zielländer waren 2024 Italien, Saudi-Arabien, die Türkei, die VAE und die USA.
Deutsche Perspektive: Partner für die Industrie
Sollten sich die Pläne zur Stärkung Ägyptens als Produktionsstandort verwirklichen, ergäbe dies ein beträchtliches Absatzpotenzial für deutsche Maschinenbauer. Zudem könnten sich dadurch Zulieferbetriebe ansiedeln. Gefragt wären dann auch spezielle Vorprodukte, etwa aus der metallverarbeitenden Industrie. Als Beschaffungsmarkt für deutsche Unternehmen spielt Ägypten bislang keine herausragende Rolle.

ALGERIEN / BAUWIRTSCHAFT: Algerien treibt Projekte im Hoch- und Tiefbau sowie im Schienenbau voran
Der Bausektor gehört seit Jahren zu den Wachstumsträgern Algeriens. Marktchancen ergeben sich vor allem für Unternehmen, die bereit sind, lokal zu produzieren. (Stand: Februar 2025)
Ausblick der Bauwirtschaft in Algerien
- Bei guter Haushaltslage weiterhin hohe staatliche Investitionen im Bausektor.
- Zahlreiche große Infrastrukturprojekte in der Umsetzung, mit zeitlichen Verzögerungen ist aber zu rechnen.
- Marktumfeld bleibt für deutsche Unternehmen herausfordernd, große Konkurrenz aus China und der Türkei.
- Starke staatliche Lokalisierungsbestrebungen in der Baustoffindustrie.
Zu den Entwicklungen in den einzelnen Bereichen (Hochbau, Tiefbau, Zulieferprodukte, Wettbewerb und Geschäftspraxis): Bauwirtschaft Algerien
Algerien baut Schienennetz von Bergwerken zu den Häfen aus
Zudem steht das algerische Schienennetz vor einem massiven Ausbau. Chinesische Firmen sind allgegenwärtig, deutsche Unternehmen loten Chancen aus.
Algerien, das größte Flächenland Afrikas, legt beim Infrastrukturausbau für die nächsten Jahre eine eindeutige Priorität auf sein Schienennetz. Von derzeit rund 4.722 Kilometern soll das Netz bis 2035 auf 15.000 Kilometer verdreifacht werden. Über 90 Prozent der algerischen Bevölkerung lebt im Norden des Landes. Hier befindet sich auch der Großteil der Schieneninfrastruktur.
Durch die Umsetzung der Vorhaben sollen der dünn besiedelte Süden besser an den entwickelteren Norden des Landes mit seinen Häfen angebunden werden. Auch die Verbindungen von West nach Ost, von der marokkanischen zur tunesischen Grenze, werden erweitert.
Zu den Projekten und Vorhaben im Einzelnen (Anbindung von Bergwerken, westliche Bergbaulinie, rollendes Material, chinesische Firmen als Partner und Beteiligungschancen für deutsche Unternehmen): Algerien baut Schienennetz von Bergwerken zu den Häfen aus | Branchen | Algerien | Schienenbau
GABUN / ENERGIE: Gabun will Kraftwerke und Stromleitungen bauen
Schwimmende Kraftwerke, private Investoren und chinesische Milliarden: Gabun muss etwas gegen seine Stromausfälle tun. Es gibt aber noch viele Fragezeichen.
Das Solarprojekt Ayémé Plaine ging im letzten Oktober mit großer Fanfare an den Start: Mit dem „größten Solarkraftwerk im zentralen Afrika“ wolle Gabun sein Stromdefizit verringern, so offizielle Stellen. Die Anlage unweit der Hauptstadt Libreville ist auf 120 Megawatt ausgelegt. Bislang sind allerdings nur 11 Megawatt in Betrieb. Die Projektentwicklung hat Solen mit Kapitalanteilen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten inne.
Gabun hat eine Versorgungskrise bei Strom
In dem zentralafrikanischen Land mit rund 2,5 Millionen Einwohnern fällt immer wieder der Strom aus. In Libreville nimmt der nationale Stromversorger Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) periodisch einzelne Bezirke vom Netz, damit andere Gebiete versorgt werden können. In den letzten 20 Jahren seien keine Investitionen in die Strominfrastruktur geflossen, so die SEEG. Dabei habe sich der Energiebedarf seit 2010 verdoppelt. Laut Stand 2019 liege der Investitionsbedarf für die Hauptstadt bei 700 Millionen Euro. Der jüngst angekündigte Strategieplan 2025-2027 der gabunischen Regierung beziffert den Investitionsbedarf für die Wasser- und Energieversorgung des gesamten Landes auf umgerechnet mehr als 4,6 Milliarden Euro.
PPP-Projekte geplant
Die gabunische Regierung will den Kraftwerkspark zügig ausbauen; dies im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften (ÖPP; englisch: PPP). Für vier Projekte mit einer Gesamtkapazität von rund 250 Megawatt gibt es private Investoren, so das für PPP zuständige Staatsunternehmen Gabon Power Company (GPC) im November 2024.
Nicht nur vor dem Hintergrund eines jahrzehntelangen Stillstands bei den Investitionen in die Stromversorgung sind Zweifel bezüglich einer zügigen Umsetzung der Projekte erlaubt. So veranschlagt die GPC für die Vorhaben Owendo und Ngoulmendjim einen Start im Jahr 2025. Konkrete Hinweise fehlen jedoch, moniert die Presse im Februar 2025.
Unklar bleibt auch der Projektstart des Wasserkraftprojektes Impératrice Eugénie. Der Anfang 2024 veröffentlichte Plan National de Développement pour la Tansition au Gabon 2024-2026 (PNDT) räumt dem 120-Megawatt umfassende Projekt Priorität ein. Gauff Egineering hatte vor Jahren Planungen dazu erstellt; Geld sollte von der China Eximbank kommen.
Nach einer Absichtserklärung vom September 2024 soll eine, nicht weiter bekannte chinesische Firma TBEA für 2,5 Milliarden US-Dollar die Wasserkraftwerke Booué in Zentral-Gabun und FE2 finanzieren. Booué würde größtenteils für den möglichen Betrieb der Eisenerzminen Baniaka und Belinga benötigt.
Schwimmende Kraftwerke gegen Stromausfälle
Zur Abhilfe der akuten Stromausfälle in Libreville liefert die türkische Firma Karpowership laut Vertrag vom Februar 2025 Strom aus schwimmenden Kraftwerken. Die Kapazität liegt bei 70 Megawatt. Dies entspricht 10 Prozent der installierten Kraftwerkskapazität des Landes.
Zuvor hatte die britische Firma Aggreko Libreville jahrelang mit Strom aus mobilen Kraftwerken an Land versorgt. Wegen Zahlungsrückständen der SEEG drohte die Firma 2024 mit dem Abbruch der Lieferungen. Dies habe, so die SEEG, die Versorgungskrise von Libreville verschärft. Hinzu kämen ausbleibende Niederschläge und deswegen oftmals zu niedrige Wasserstände für den Betrieb von Wasserkraftanlagen.
Finanzierung für geplante Stromtrassen unklar
Der Ausbau von Stromleitungen steht ebenfalls auf der Agenda. Gemäß Stand vom Januar 2025 setzt die GPC eine Verbindung des geplanten kleinen Gaskraftwerks Mayumba mit der Stadt Tchibanga (110 Kilometer, 30 Kilovolt, 46 Millionen Euro) um. An dem Projekt ist unter anderem Perenco beteiligt. Auf Anfrage von Germany Trade & Invest gab das in London ansässige Unternehmen, das in Gabuns Öl- und Gasgeschäft involviert ist, keine Auskunft.
Der bereits erwähnte Entwicklungsplan PNDT listet weitere Projekte für Stromtrassen auf, für die es aber keine Hinweise auf eine Finanzierung gibt. Wichtigstes Projekt wäre hier die 225-Kilovolt-Verbindung von Fougamou zur Verteilstation Ntoum 2 (bei Ayémé Plaine) inklusive einer 225/30-Kilovolt-Station in Bifoun. Auf der PNDT-Liste stehen auch die Trassen Fougamou – Mouila (90 Kilovolt, 53 Millionen Euro), Cogo (Äquatorialguinea) – Ntoum (110 Kilovolt, 38 Millionen Euro) sowie Bafoula – Lastourville (225 Kilovolt, 53 Millionen Euro inklusive Verteilerstationen).
Überhöhte Kosten veranschlagt?
Auffallend sind die hohen Investitionen, die GPC für seine Wasserkraftvorhaben veranschlagt: 1 Megawatt Leistung kostet demnach rund 5 bis 8 Millionen Euro. Beim größten Gaskraftwerk Owendo sind es 2,4 Millionen Euro. International ist gemäß spanischem Investment-Consultant ESFC bei Wärmekraftwerken mit 1,2 bis 1,5 Millionen Euro pro Megawatt zu rechnen. Bei der Wasserkraft seien es 2022 weltweit im Schnitt 1,9 Millionen Euro gewesen.
Laut PNDT lagen die Stromerzeugungskapazität in Gabun 2023 bei insgesamt 704 Megawatt. Davon entfielen 380 Megawatt auf Gas- und Dieselkraftwerke (Gasoil) und 324 Megawatt auf vier Wasserkraftwerke. Aktuell nutze man Hydroenergie nur an sieben von insgesamt 60 identifizierten Stellen, die bei voller Nutzung eine Kapazität von fast 5.800 Megawatt garantieren könnten. Seit Februar 2025 importiert Gabun Strom aus dem benachbarten Äquatorialguinea. Es handelt sich dabei allerdings nur um zunächst 3 von maximal 10 Megawatt.
Relativ reiches Land
Der Ölstaat Gabun ist im innerafrikanischen Vergleich wohlhabend. Die Afreximbank verweist aber in einem aktuellen Report auf eine wachsende öffentliche Verschuldung. Positiv für die wirtschaftliche Stabilität werten Beobachter die Wahl am 12. April 2025 des bisherigen Übergangspräsidenten Brice Oligui zum Staatsoberhaupt. Mit dieser löst er die 56-Jährige, bis 2023 währende Herrschaft der Bongo-Familie endgültig ab.
KAMERUN / MARKT: Wie Kameruns Diaspora deutschen Firmen in den Markt hilft
In Deutschland leben zehntausende Kameruner, viele haben hier studiert. Die IT-Spezialisten, Handelsvertreter oder anderen Fachkräfte sind potenzielle Brückenbauer nach Afrika.
Manchmal scheinen Dinge einfach zusammenzupassen. Der Fachkräftemangel in Deutschland zum Beispiel mit einer kleinen Firma in Yaoundé, der Hauptstadt von Kamerun. Dort erzählt Aristode Tchouffak, einer der vier Mitarbeiter, wie er mit einem deutschsprachigen Kollegen einen Kunden in Deutschland bei der digitalen Vermarktung von dessen GPS-Trackern unterstützt.
IT-Firma in Yaoundé arbeitet für deutsche Kunden
„Ich bin so froh, dass ich hier meine Fähigkeiten einbringen kann“, sagt Aristode Tchouffak in fehlerfreiem Deutsch.
Der Kameruner hat in Frankfurt am Main Informationstechnik studiert, musste mit Ausbruch der Corona-Pandemie aber in sein Heimatland zurückkehren. Aus der angestrebten IT-Karriere in Deutschland wurde nichts.
Tchouffaks Chef war 2006 ebenfalls zum Studium nach Deutschland gegangen: Leonel Moukam besitzt einen Abschluss in Mechatronik der Hochschule Esslingen und setzte später noch den Master of Business Administration (MBA) drauf. Der Kameruner arbeitet aktuell bei einer Firma in Göppingen. Vor knapp zwei Jahren gründete er zusätzlich seine Firma in Yaoundé, die neben digitalem Marketing auch Softwareentwicklung und Customer Support anbietet. Moukam will damit seine Kontakte in Deutschland zusammenbringen mit „den vielen Kamerunern ohne richtigen Job, die Deutsch können und Fähigkeiten mitbringen, die in Deutschland dringend benötigt werden“.
Viele kamerunische Studierende in Deutschland
Laut Ausländer-Zentralregister lebten 2024 insgesamt 36.565 Kameruner in Deutschland. Das waren doppelt so viele, wie noch zehn Jahre zuvor. Und viele von ihnen sind gut ausgebildet. „Zum Zweck der Ausbildung“ befanden sich nach Maßgabe des Aufenthaltstitels anteilsmäßig nur Personen aus China und Indonesien öfter in Deutschland als aus Kamerun. An deutschen Hochschulen studierten im Wintersemester 2023/2024 laut Statistischem Bundesamt 6.982 Personen aus Kamerun. Von allen afrikanischen Nationalitäten stellte Kamerun damit nach Ägypten und Marokko die drittgrößte Gruppe und lag insgesamt auf Rang 18.
Auch Francis Pouatcha hatte in Deutschland studiert. Nach dem Abschluss in Wirtschaftsinformatik in Nürnberg gründete der gebürtige Kameruner – der längst die deutsche Staatsangehörigkeit hat – 2006 dort die Firma adorsys. Der Softwareentwickler beschäftigt heute insgesamt 200 Mitarbeitende in Deutschland, Irland, Rumänien – und inzwischen auch in Kamerun. „Unsere Mitarbeitenden liefern nach schätzungsweise zwei Jahren Berufserfahrung die gleiche Qualität dort ab wie Teammitglieder in Deutschland“, sagt Pouatcha im Interview mit dem Africa Business Guide. Dafür zahlen die Kunden Tagessätze, die nur ein Drittel oder gar ein Zehntel so hoch sind wie die der Teammitglieder in Deutschland.
Brückenbauer nach Afrika
Tchouffak, Moukam und Pouatcha sind nur einige Bespiele für Kameruner, die wirtschaftliche Brücken zwischen ihrer Heimat und Deutschland bauen. Über solche Brücken könnten auch deutsche Firmen in Kamerun aktiv werden. Wie die sich allerdings finden und nutzen lassen, jenseits von LinkedIn und anderen sozialen Netzwerken, ist weniger klar. Der „klassische“ Weg über Verbände jedenfalls gestaltet sich zumindest unübersichtlich.
Yannick Guetse ist ein kamerunischer Informatiker in Erlangen – und Mitgründer der Vereinigung BDI. Das steht allerdings nicht für den Bundesverband der Deutschen Industrie, sondern für die Bantu Development Initiative. Der Verein mit Anschriften in Erlangen und Yaoundé will laut Webseite den interkulturellen Dialog zwischen Afrika, insbesondere Kamerun, und Deutschland fördern. Er dürfte deutschen Firmen, die ein Geschäft in Afrika aufbauen wollen, nicht sofort ins Blickfeld geraten. Dabei vertritt Guetse bereits mehrere deutsche Firmen im zentralen Afrika, unter anderem den westfälischen Agrartechnik-Anbieter Riela.
Diaspora-Verbände bieten diffuses Bild
„Die kamerunischen Studenten in Deutschland haben einen ungewöhnlichen Hang zur Vereinsbildung“, sagt ein langjähriger Beobachter der deutsch-afrikanischen Wirtschaftsbeziehungen. Was im Ergebnis zu einem diffusen Gesamtbild mit einer Vielzahl unterschiedlichster Vereinigungen hierzulande beiträgt. Eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) identifizierte insgesamt 85 Organisationen der Kamerun-Diaspora in Deutschland. Die Studie stammt zwar von 2016, sie gibt aber den wohl immer noch umfassendsten Überblick zu dem Thema.
Als einen guten Anknüpfungspunkt nennt die Studie den Challenge Camerounais e.V. Dieser Verein in Hamburg veranstaltet ein gleichnamiges Event, das nächste Mal am 7. und 8. Juni 2025. Dabei geht es außer um Fußball, Essen oder Musik auch um den Austausch zwischen Geschäftsleuten und Fachleuten.
Die meisten kamerunischen Vereinigungen kümmern sich laut der GIZ-Studie um kulturelle und studentische Belange und die „internationale Solidarität“. Fachvereinigungen wie Camfomedics sind die Ausnahme. Die Vereinigung von Ärzten, Apothekern und anderem medizinisch-pharmazeutischem Fachpersonal hatte im letzten Oktober in Hannover das „30. Deutsch-Kamerunische Ärztetreffen“ veranstaltet. Für den IT-Sektor nennt Francis Pouatcha den Verein Kamerunischer IngenieurInnen und InformatikerInnen (VKII).
Wirtschaftsverband steht vor Gründung
„Einen Fokus auf Wirtschaft hat keine der kamerunischen Vereinigungen in Deutschland“, sagt André Kwam. Dies zu ändern ist Ziel des Honorarkonsuls Deutschlands in Kamerun mit Sitz in der Wirtschaftsmetropole Douala. Der gelernte Ingenieur will nach eigenen Worten ein „Deutsch-Kamerunisches Wirtschaftsforum für Entwicklung“ gründen. In Kamerun gibt es keine deutsche Auslandshandelskammer (AHK). Das Land wird, ebenso wie die anderen frankofonen Länder West- und Zentralafrikas, von der AHK in Côte d’Ivoire betreut.
Mit seinem Verband will Kwam eine Brücke für deutsche Firmen mit Interesse an Kamerun sein. Der Honorarkonsul möchte namentlich gebürtige Kameruner in deutschen Firmen dabei unterstützen, das Engagement ihrer Arbeitgebende in ihrem Heimatland voranzutreiben. Zudem solle der Verband in der Zusammenarbeit mit dortigen Behörden vermitteln.
MAROKKO / BAUWIRTSCHAFT: Marokkos Bauwirtschaft expandiert trotz Herausforderungen
Öffentliche und private Investitionen sind Wachstumstreiber im Bausektor. Fachkräftemangel, die schwierige Auftragsakquise und der recht große informelle Sektor bremsen punktuell. (Stand: März 2025)
Ausblick der Bauwirtschaft in Marokko
- Öffentliche Bauinvestitionen für Transport, Verkehr und Energie.
- Private Bauinvestitionen für Wohnen, Gesundheit, Bildung und Energie.
- Fußball-WM 2030 lockt Auslandsinvestoren.
Zu den Entwicklungen in den einzelnen Bereichen (Hochbau, Tiefbau, Zulieferprodukte, Wettbewerb und Geschäftspraxis): Bauwirtschaft Marokko
MAROKKO / ENERGIE: Marokko kündigt neue LNG- und Kraftwerksvorhaben an
In Marokko zeichnen sich umfangreiche Investitionen im Energiesektor ab. Daraus ergeben sich gute Absatzchancen für deutsche Anlagenbauer.
Sowohl das Ministerium für Energie und Transformation (MTEED) als auch der staatliche Strom- und Wasserversorger (ONEE) planen Ausschreibungen zur Sicherung der Gas- und Stromversorgung.
Zu den Vorhaben des Energieministeriums (Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable) zählen insbesondere ein schwimmender Flüssiggasterminal (LNG-Terminal) im Hafen Nador West Med an der Mittelmeerküste sowie zwei weitere LNG-Terminals an der Atlantikküste. Für die beiden letztgenannten Projekte ist die Suche nach geeigneten Standorten noch nicht abgeschlossen. Ebenso ist der Bau dreier Erdgaspipelines vorgesehen.
ONEE (Office National de l’Électricité et de l’Eau potable) hat die Ausschreibung eines 600-Megawatt-Gaskraftwerks angekündigt, ebenso drei weitere Anlagen von jeweils 150 Megawatt zur Stabilisierung des Netzes. Im Februar 2025 vergab ONEE in der Nähe der nördlichen Provinzhauptstadt Ouazzane den Bau eines Gaskraftwerks (Al Wahda).
LNG-Terminals und drei Pipelineprojekte in der Vorbereitung
Der Bau des LNG-Terminals im Hafen Nador West Med umfasst einen LNG-Speicher und eine Regasifizierungsanlage. Das Energieministerium hat für das Großprojekt ein Verfahren zur Interessensbekundung eingeleitet, das bis Ende Juni 2025 läuft. Die Ausschreibung wird danach zeitnah erfolgen, so offizielle Stellen. Alle drei LNG-Anlagen sollen schon 2027 in Betrieb gehen.
Die Ausschreibung umfasst den Bau, die Finanzierung und den Betrieb der Anlagen. Damit setzt das Ministerium einen Regierungsbeschluss um, private Investoren insbesondere bei Infrastrukturprojekten zu beteiligen. Die marokkanische Regierung hat für die privaten Betreiber, die den Zuschlag erhalten, Investitionsanreize in Aussicht gestellt.
Die mit 130 Kilometern längste der drei geplanten Pipelines verbindet den Hafen Nador mit der Maghreb-Europe Gas Pipeline, die im Landesinneren parallel zur Mittelmeerküste verläuft. Die zweite Erdgasleitung, deren Länge 13 Kilometer beträgt, schließt das Industriegebiet der Küstenstadt Keneitra (rund 38 Kilometer nördlich von Rabat) an eine Nord-Süd verlaufende Gasleitung an. An dieselbe Achse ist eine 10 Kilometer lange Anschlusspipeline für das Industriegebiet Mohammedia (zwischen Casablanca und Rabat) vorgesehen.
ONEE baut neue Gaskraftwerke
Der Energiekonzern ONEE möchte das Erdgas aus dem LNG-Terminal bei Nador zur Stromerzeugung nutzen und wird in unmittelbarer Hafennähe den Bau eines Gaskraftwerks ausschreiben. Das Kraftwerk setzt sich aus zwei Blöcken mit jeweils 600 Megawatt Leistung zusammen.
Für Kenitra und Mohammedia plant ONEE jeweils den Bau eines Kraftwerks mit 150 Megawatt. Sie sollen sowohl Erdgas als auch Gasöl verbrennen können. Beide Kraftwerke dienen dazu, Nachfragespitzen im örtlichen Verteilernetz abzudecken. Eine dritte Anlage mit einer Kapazität von 150 Megawatt hat ONEE für das im Nordosten Marokkos gelegene Ain Beni Mathar avisiert.
Für das bereits erwähnte Kraftwerk Al-Wahda hat ONEE im Februar 2025 ein japanisch-chinesisches Konsortium bestehend aus Mitsubishi Power und China Energy Engineering Corporation ausgewählt. Der Planung zufolge wird das für die Provinz Ouazzane vorgesehene Elektrizitätswerk zwei Gasturbinen mit einer Kapazität von jeweils 450 Megawatt umfassen. An der Finanzierung beteiligen sich ONEE zu 20 Prozent und ein marokkanisches Bankenkonsortium zu 80 Prozent. Im Unterschied zu den LNG-Anlagen verbleiben die beiden großen Gaskraftwerke (Nador und Ouazzane) und die drei Backup-Anlagen (Kenitra, Mohammedia und Beni Mattar) unter der vollen Kontrolle der staatlichen ONEE.
MAROKKO / METALL: Marokko reguliert Export von Kupfer und Aluminium
Für raffiniertes Kupfer und Aluminium in Barrenform gilt in den nächsten 24 Monaten eine Exportlizenzpflicht.
Marokko schränkt den Export von Kupfer und Aluminium in Rohform für einen Zeitraum von 24 Monaten ein. Es handelt sich dabei um Produkte, die unter den folgenden marokkanischen Zolltarifnummern geführt werden:
- Kupfer: ex 7403.19.00.00, ex 7403.22.00.00, ex 7403.29.00.00
- Aluminium: ex 7601.10.00.00, ex 7601.20.00.00.
Für den Export dieser Produkte ist eine behördliche Lizenz notwendig.
SIERRA LEONE / BRANCHEN: Branchen mit Wachstumspotenzial
Trotz vieler Herausforderungen gibt es positive Entwicklungen in der Wirtschaft. Geschäftschancen bieten die Branchen Agrarwirtschaft und Bergbau sowie Infrastrukturprojekte.
Die Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung verfügen dank guter klimatischer Bedingungen und ausreichenden Wasserressourcen über ein hohes Potenzial: Durch den Ausbau der lokalen Produktion können sich künftig auch für deutsche Unternehmen Chancen ergeben. Dies gilt grundsätzlich für die gesamte Wertschöpfungskette: Lebensmittelverarbeitung, Kühlung, Verpackung und Logistik. Bereits jetzt nutzen einige Unternehmen vor Ort Maschinen aus Europa mit Steuerungstechnik aus Deutschland. Diese möchten sie künftig durch deutsche Fabrikate ersetzen, wenn der Preis stimmt.
Viel ungenutztes Potenzial in der Lebensmittelproduktion und -verarbeitung
Der Agrarsektor trägt fast 30 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei und beschäftigt 65 Prozent der Erwerbstätigen. Das jährlich reale Wachstum betrug in den letzten fünf Jahren (2019 bis 2023) durchschnittlich 3,3 Prozent. Nur 15 Prozent der 5,4 Millionen Hektar der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen sind kultiviert.
Die lokale Produktion kann trotz vieler agrarischer Rohstoffe wie Reis, Kassava, Tropenfrüchte und Ölpalme, den Bedarf an Grundnahrungsmitteln nicht decken. Schätzungsweise 80 Prozent der Lebensmittel werden importiert, dies entspricht rund 400 bis 500 Millionen US-Dollar (US$) jährlich.
Chancen bieten deshalb die Produktion und Verarbeitung lokaler Nahrungsmittel. Noch ist der Verarbeitungsgrad gering, Unternehmen konzentrieren sich auf die Gewinnung und den Handel von Rohstoffen. So gehen Kakao, Kaffee und Holz zum größten Teil unverarbeitet in den Export, auch nach Europa. Das soll sich nach Plänen der Regierung ändern, die sowohl die Produktion als auch die lokale Verarbeitung steigern möchte.
Bislang gibt es noch wenig lebensmittelverarbeitende Unternehmen. Zu den führenden Firmen gehört Capitol Foods, die Getränke (Wasser und Fruchtsäfte) und Kakaoprodukte (Kakaomasse, – butter und -pulver) für den lokalen Markt und Export herstellt. Das Unternehmen Lizard Earth ist das einzige deutsche Unternehmen in der Branche. Es ist im Kakaohandel tätig und exportiert in die EU. Ab Mitte 2025 soll eigene Schokolade hergestellt werden.
Ausbau der Fischzucht durch Förderung von Aquakulturen geplant
Die Regierung Sierra Leones möchte den Bereich Aquakultur und Fischfang verstärkt fördern und hat dazu Ende 2024 eine „Blue Economy Strategy“ erlassen. Die Fischerei trägt 6 Prozent zum BIP bei und beschäftigt etwa 500.000 Personen, wobei die meisten im artisanalen Fischfang tätig sind. Der lokale Fischkonsum beträgt 22,6 Kilogramm pro Kopf mit steigender Tendenz.
Pro Jahr werden im Bereich der industriellen Fischerei 122.000 Tonnen Fisch (Stand: 2023) produziert. Davon wird fast die Hälfte lokal verkauft, der Rest geht in den Export. In die EU führt Sierra Leone bislang keinen Fisch aus, dies soll ab diesem Jahr oder ab 2026 möglich sein. Bis zum Jahr 2030 wird eine Menge von 150.000 Tonnen angestrebt. Dies soll durch eine Erhöhung der Fangmenge und den Ausbau der Fischzucht erreicht werden. Vor allem die Zucht von Shrimps und Austern in Aquakulturen bietet Potenzial, hier unterstützt Island seit 2018 in den Bereichen nachhaltige Entwicklung sowie Aus- und Fortbildung.
Der Ausbau der Fischzucht in Aquakulturen wird die Nachfrage – unter Berücksichtigung der Preissensibilität – nach modernen Haltungssystemen, Lösungen für das Recycling von Wasser und Kreislaufanlagen steigern. Zudem dürfte der Bedarf an Fischfutter zunehmen, das bislang noch nicht lokal hergestellt wird.
Verkehrsinfrastruktur soll ausgebaut und modernisiert werden
Im mittelfristigen nationalen Entwicklungsplan (2024 bis 2030) sind eine Reihe von Straßenbauprojekten und die Instandhaltung von Brücken vorgesehen. Ein Großprojekt ist eine 8 Kilometer lange Brücke, die die Hauptstadt Freetown mit dem internationalen Flughafen in Lungi verbinden soll. Die Kosten werden auf etwa 1,1 Milliarden US$ geschätzt. Dazu wurde bereits im Jahr 2023 eine Absichtserklärung mit der China Road and Bridge Corporation und dem senegalesischen Architektenbüro Atepa Group unterzeichnet.
In der Hauptstadt Freetown ist zur Entlastung des Verkehrsnetzes der Bau einer 3,6 Kilometer langen Seilbahn für den Nahverkehr geplant, die vom Central Business District (CBD) bis zum Kissy Ferry Terminal gehen soll. Die Linie soll über fünf Stationen verfügen und die Gesamtfahrzeit lediglich 15 Minuten betragen. Pro Stunde können rund 3.000 Passagiere befördert werden. Eine entsprechende Machbarkeitsstudie wurde im Oktober 2024 fertiggestellt.
Aufgrund der geplanten Projekte der Regierung dürfte die Nachfrage nach Planungs- und Ingenieursdienstleistungen sowie Baudienstleistungen zunehmen. Zudem wird der Bedarf nach Baumaterialien steigen. Hier können sich für deutsche Unternehmen interessante Beteiligungsmöglichkeiten ergeben. Auch für Unternehmen im Bereich der urbanen Seilbahntechnik sowie Service und Wartung können sich Chancen ergeben.
Bergbau bietet weiterhin Chancen
Der Bergbausektor spielt wirtschaftlich eine wichtige Rolle, er trägt rund 10 Prozent zum BIP bei und generierte im Jahr 2023 etwa 80 Prozent der Exporteinnahmen. Nach einem Einbruch im Jahr 2020 konnte der Sektor mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 45 Prozent aufgrund der Wiederöffnung einiger Minen nach der Coronapandemie und des Abschlusses neuer Lizenzverträge wieder zulegen. Sierra Leone baut unter anderem Eisenerz, Diamanten, Bauxit, Gold und Titanmineralien wie Rutil ab. Das Land ist eines der größten Titanlieferanten weltweit. Zudem verfügt Sierra Leone über Vorkommen von Chromit, Nickel und Coltan sowie Lithium, wobei letzteres bislang noch nicht gefördert wird.
Aufgrund der Entdeckung neuer Vorkommen, einer verbesserten Geo-Datenlage, und der weltweit steigenden Nachfrage nach Rohstoffen wie Lithium, Coltan und Bauxit gehen Branchenkenner von einer Zunahme von Aktivitäten im Sektor aus. Daraus können sich Zulieferchancen für Bergbaumaschinen und Baumaschinen ergeben. Zudem dürften Ingenieurs- und technische Dienstleistungen verstärkt nachgefragt werden.
SÜDAFRIKA / ANTIDUMPING: Schutzmaßnahmen für Einfuhren flachgewalzter Eisen- und Stahlprodukte
Südafrika setzt den Zollsatz stufenweise herab. Ausnahmen gelten für bestimmte Länder.
Von der Schutzmaßnahme sind Einfuhren bestimmter flachgewalzter Erzeugnisse aus Eisen, nicht legiertem Stahl oder anderem legiertem Stahl (ausgenommen nichtrostender Stahl), auch in Rollen (Coils), (einschließlich zugeschnittene Erzeugnisse und Schmalband), nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit Ausnahme von kornorientiertem Silizium-Elektrostahl, betroffen. Die Waren werden in folgende Zolltarifnummern eingereiht: 7208.10, 7208.25, 7208.26, 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.40, 7208.51, 7208.52, 7208.53, 7208.54, 7208.90, 7211.14, 7225.30, 7225.40, 7225.99 und 7226.99.
Die Maßnahme wird stufenweise umgesetzt. Der Zollsatz wird wie folgt stufenweise herabgesetzt:
- Mai 2025 – 1. Mai 2026: 13 Prozent
- Mai 2026 – 1. Mai 2027: 11 Prozent
- Mai 2027 – 1. Mai 2028: 9 Prozent
Zahlreiche Entwicklungsländer sind von dieser Maßnahme ausgenommen.
Zum Hintergrund
Grund der Schutzmaßnahmenuntersuchung war der Verdacht einer ernsthaften Schädigung, die durch den Anstieg der Einfuhren von solchen Eisen- und Stahlprodukten verursacht wurde. Mit der Einleitung des Verfahrens wurde die Absicht verfolgt, eine ernsthafte Schädigung des inländischen Wirtschaftszweiges, der gleichartige Ware herstellt, zu beheben oder zu verhindern.
SÜDAFRIKA / UMSATZSTEUER: Änderungen bei der südafrikanischen Umsatzsteuer
In Südafrika gelten nun Erleichterungen für ausländische Unternehmen, die elektronische Dienstleistungen erbringen. Die Umsatzsteuer soll zudem erhöht werden.
Seit 1. April 2025 müssen sich ausländische Erbringer von elektronischen Dienstleistungen nicht mehr steuerlich registrieren und die Umsatzsteuer ausweisen, wenn sie ihre Dienstleistung ausschließlich an steuerlich registrierte südafrikanische Unternehmen erbringen. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
- Alle Kunden des Unternehmens müssen in Südafrika steuerlich registriert sein.
- Das ausländische Unternehmen muss die Registrierung ihrer Kunden nachweisen und den Nachweis aufbewahren.
- Werden Dienstleistungen auch an nicht registrierte Unternehmen erbracht, entfällt die Befreiung insgesamt.
Sofern der ausländische Dienstleistungserbringer von der Registrierungspflicht befreit ist, gilt eine Art Reverse-Charge-Verfahren. Das bedeutet, dass nicht mehr der ausländische Dienstleistungserbringer, sondern der südafrikanische Dienstleistungsempfänger verpflichtet ist, die Umsatzsteuer auszuweisen.
Darüber hinaus soll der Umsatzsteuersatz steigen, und zwar zum 1. Mai 2025 auf 15,5 Prozent und zum 1. April 2026 auf 16 Prozent. Für den Übergangszeitraum richtet sich der Umsatzsteuersatz nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung. Die Vorsteuer für erbrachte Leistungen nach Erhöhung des Umsatzsteuersatzes muss in Höhe des anzuwendenden Satzes geltend gemacht werden.
SÜDLICHES AFRIKA / ERZE: Südliches Afrika positioniert sich mit batteriefähigem Mangan
Im Südlichen Afrika steigen Unternehmen in Produktion von Mangansulfat ein, einem Vorprodukt für die Batterieherstellung. Zielmärkte sind Europa und Nordamerika.
Zwei Drittel des weltweiten Abbaus von Mangan entfallen auf Afrika. Um es für die Herstellung von Batterien zu verwenden, muss das Metall allerdings erst zu Mangansulfat weiterverarbeitet werden. Dies geschieht zu mehr als 90 Prozent in China. Mit dem Ziel, alternative Lieferketten aufzubauen, planen Unternehmen, das Kathoden-Vorprodukt HPMSM (High Purity Manganese Sulphate Monohydrate) außerhalb Chinas herzustellen. Die Länder im Südlichen Afrika mit ihren umfangreichen Vorkommen rücken dabei besonders in den Fokus.
Steigende Nachfrage durch neue Batterietechnologie
Zukünftig wird Mangan bei der Herstellung von Kathoden mehr Verwendung finden. Mit neuen Verfahren kann es Anteile der bislang verwendeten Metalle Nickel und Kobalt ersetzen. Mangan ist billiger als die anderen Batteriemetalle und verbessert zudem die thermische Stabilität. Nebeneffekt: Auch die Abhängigkeit von der Demokratischen Republik Kongo bei Kobalt und von Russland bei Nickel verringert sich.
Bleibt die Abhängigkeit von China. Erste Ansätze alternativer Produktionsstandorte für HPMSM gibt es in Europa und Amerika. In Tschechien plant das kanadische Unternehmen Euro Manganese die Wiederaufbereitung von Mangan-Altbeständen aus einer stillgelegten Mine. Der US-amerikanische Konzern Vibranz produziert in Belgien und Mexiko. Das Unternehmen plant, die Produktion auf jährlich 45.000 Tonnen zu steigern. Chinesische Unternehmen haben 2024 demgegenüber 2024 rund 305.000 Tonnen HPMSM geliefert – Tendenz steigend. Nippon Denko in Japan mit einer Jahresproduktion von 1.000 Tonnen ist ein weiterer Hersteller, exportiert allerdings nicht.
Südliches Afrika Schwerpunkt für strategische Mangan-Lieferketten
Auch im Südlichen Afrika wollen Bergbaukonzerne vermehrt eine Raffinierung von batteriefähigem Mangan aufbauen. Bezeichnenderweise sind die Reinheitsgrade der Manganerze dort hoch und können für die Kathodenherstellung verwendet werden. Das in China abgebaute Mangan ist hingegen weitgehend untauglich für die Batterieherstellung.
In Südafrika ist das HPMSM-Projekt der Manganese Metal Company (MMC) weit fortgeschritten. Die Anlage in Mbombela (ehemals Nelspruit) ist im Bau und liefert 6.000 Tonnen ab 2026, so die Leiterin der Marketingabteilung des traditionsreichen Unternehmens, Madeleine Todd, gegenüber Germany Trade & Invest (GTAI). Seit den 1970er Jahren exportiert MMC hochreines elektrolytisches Mangan (EMM), das unter anderem ebenso der Kathodenherstellung diene und der HPMSM-Produktion vorgeschaltet sei. „Die Lieferung von HPMSM nimmt dem Kathodenhersteller aufwändige Verfahrensschritte ab“, so Todd. „Die Herstellung ein technologisch schwieriges Unterfangen, das wir mittlerweile gut beherrschen“, erklärt die Ingenieurin für Verfahrenstechnik mit gewissem Stolz.
Projekte in Namibia, Botsuana und Südafrika
Nicht ganz so weit entwickelt ist das HPMSM-Vorhaben von Green Metals Refining Namibia (GMRN) in Namibia. Das Unternehmen plant den Bau einer Manganraffinerie östlich der Küstenstadt Walvis Bay. Der Start der Raffinerie ist für 2027 vorgesehen. GMRN will das Erz hauptsächlich aus dem Kalahari-Manganfeld in Südafrika beziehen. Den Angaben des Unternehmens zufolge wird die Anlage in mehreren Phasen ausgebaut und bis 2032 ihre volle Kapazität erreichen. GMRN ist eine Tochtergesellschaft der britischen Green Metals Refining.
In Botsuana plant das kanadische Unternehmen Giyani Metals das K.Hill-Projekt für den Abbau und die Herstellung von hochreinem Manganoxid (High-Purity Manganese Oxide; HPMO), einer weiteren Vorstufe für HPMSM. Der Standort liegt rund 60 km südöstlich der Hauptstadt Gaborone. Das kanadische Unternehmen hat bereits eine Demonstrationsanlage in Johannesburg in Betrieb genommen. Ursprünglich war geplant, im ersten Quartal 2025 mit der kommerziellen HPMO-Produktion zu starten. Bislang ist diese offenbar nicht angelaufen. Eine Anfrage von GTAI hierzu blieb unbeantwortet.
Jupiter Mines will aus den niedriggradigen Manganerzhalden der Tshipi Mine in der südafrikanischen Nordkap-Provinz batteriefähiges Mangan gewinnen und dieses in Partnerschaft mit anderen Unternehmen zu HPMSM verarbeiten. Der Start der HPMSM-Produktion ist für 2028 geplant, so der Geschäftsführer Brad Rogers zu GTAI. Wo die geplante HPMSM-Produktionsanlage errichtet wird, ist laut Rogers noch offen.
Herstellung von HPMSM ist technologisch herausfordernd
Bei den weltweiten Ankündigungen zur HPMSM-Herstellung ist nicht nur mit Bezug auf Afrika Vorsicht geboten, so Experten. Die Produktion von HPMSM außerhalb Chinas dürfte kaum günstiger sein und wird wohl vor allem aus strategischen Gründen geschehen. Die Kostenvorteile in China seien nicht nur auf die niedrigen Energiekosten dort zurückzuführen, sondern auch auf den technischen Vorsprung der chinesischen Unternehmen. Auch sei nicht immer klar, ob tatsächlich Kathodenhersteller als Abnehmer außerhalb Chinas zu finden sind. Denn der Aufbau von Batterieproduktionen außerhalb Chinas umfasst in der Regel eben nicht die Produktion von Kathoden oder Anoden. „Nur in diesem Falle sei eine vollwertige Strategie zur Minderung von Abhängigkeiten zu bewerkstelligen“, warnt Madeleine Todd.
Manganabbau in Afrika mit neuem Fokus
In Südafrika, dem größten Produzenten von Mangan, wird das Erz insbesondere im Kalahari-Becken in der Provinz Northern Cape abgebaut. Gabun ist das weltweit drittgrößte Förderland. Allerdings fällt das zentralafrikanische Land bei den Reserven deutlich zurück. Am bedeutendsten ist in Gabun die Moanda-Mine, in der das Bergbauunternehmen Comilog Mangan abbaut. Comilog gehört zu 75 Prozent zum französischen Unternehmen Eramet. In Ghana sind die Fördermengen deutlich geringer als in Südafrika und Gabun. Den Manganabbau dort bewerkstelligt die Ghana Manganese Company Limited (GMC). Wie in Botsuana gibt es kleinere, aber relevante Vorkommen auch in Namibia, Côte d`Ivoire, Burkina Faso und der Demokratischen Republik Kongo.
Amerika
ARGENTINIEN / AGRAR: Argentiniens Ernährungswirtschaft vor Trendwende
Nach Jahren der Stagnation sieht die Branche die Zukunft verhalten optimistisch. Das Rezessionsende sollte den Menschen höhere Lebensmittelausgaben erlauben. Die Importe steigen.
Ausblick der Nahrungsmittelindustrie Argentinien
- Die Politik hat eine Marktöffnung und eine Reduzierung staatlicher Eingriffe versprochen.
- Eine Reihe von Maßnahmen wurde bereits umgesetzt, viele stehen noch aus.
- In- und externe Unwägbarkeiten können den Erfolg verlangsamen oder sogar zunichtemachen – doch insgesamt überwiegt die Hoffnung.
Zu den Markttrends und der Branchenstruktur: Ernährungswirtschaft Argentinien
BOLIVIEN / ZÖLLE: Neues Ursprungszeugnis für den Warenverkehr in der Andenzone
Zurzeit findet das neue Ursprungszeugnis Anwendung zwischen Kolumbien und seinen Andenpartnern im bilateralen Handel.
Die Mitgliedstaaten der Andengemeinschaft CAN (Kolumbien, Bolivien, Ecuador und Peru) haben sich Ende 2024 mit Resolution 2455 auf die Einführung eines neuen Ursprungszeugnisses geeinigt. Dieses soll den interzonalen Handel erleichtern und die damit zusammenhängenden Verfahren digitalisieren.
Kolumbien setzt das Ursprungszeugnis für den bilateralen Handel mit seinen Partnerstaaten dieses Jahr allmählich ein. Für seine Implementierung in Bolivien, Ecuador und Peru sind unterschiedliche Ausstellungsformate (physisch und digital) sowie verschiedene Fristen vorgesehen. Ziel ist, das Ursprungszeugnis in digitaler Form im „Sistema Informático de Origen“ zu verwalten. Hierzu muss jedes Land die notwendigen Schritte beziehungsweise Prozesse der Digitalisierung vornehmen, die sie mit Kolumbien bilateral vereinbart haben.
Weitere Details zur Implementierung des neuen Ursprungszeugnisses in Bolivien, Ecuador und Peru gibt die kolumbianische Zollverwaltung bekannt.
BRASILIEN / BAUWIRTSCHAFT: Wachstum der Bauwirtschaft setzt sich 2025 fort, aber langsamer
Das Jahr 2024 war überraschend gut für die brasilianische Bauwirtschaft. Sozialer Wohnungsbau und Tiefbau sorgen auch 2025 für Impulse. Doch steigende Zinsen bremsen Investitionen.
Ausblick der Bauwirtschaft in Brasilien
- Das soziale Wohnungsbauprogramm MCMV kurbelt den Bau von Häusern für Haushalte mit niedrigem bis mittlerem Einkommen an.
- Die Vergabe von Konzessionen an private Betreiber sorgt für Investitionen in die Wasserwirtschaft, den Bau von Autobahnen und weitere Projekte.
- Der gestiegene Leitzins dürfte sich spätestens ab dem 2. Halbjahr 2025 bremsend auf die Baukonjunktur auswirken.
Zu den Entwicklungen in den einzelnen Bereichen (Hochbau, Tiefbau, Wettbewerbssituation und Geschäftspraxis sowie Zulieferprodukte): Bauwirtschaft Brasilien
BRASILIEN / CHEMIE: Brasiliens Chemieindustrie erwartet Trendwende
Nach schwachen Jahren steht Brasiliens Chemieindustrie am Wendepunkt. Viele Faktoren sprechen dafür, dass Produktion und Investitionen wieder Auftrieb erhalten.
Ausblick der chemischen Industrie in Brasilien
- Brasiliens Nachfrage nach chemischen Produkten wächst.
- Davon profitierten bislang vor allem ausländische Anbieter; rund 45 Prozent der Nachfrage nach Industriechemikalien deckt Brasilien heute über Importe.
- Höhere Einfuhrzölle sollen die lokale Produktion stimulieren.
- Förderprogramme und Investitionen des Agrobusiness sowie des Öl- und Gassektors lassen die Produktion von Düngemitteln und Kraftstoffen steigen.
Zu den Markttrends, Branchenstruktur und Nachhaltigkeit: Chemische Industrie Brasilien
VENEZUELA / WIRTSCHAFTSRECHT: Venezuela verhängt wirtschaftlichen Notstand
Neues Dekret sorgt für Rechtsunsicherheit für ausländische Unternehmen im Land.
Am 10. April 2025 hat der venezolanische Kongress das von der Regierung erlassene Dekret zum wirtschaftlichen Notstand (Decreto 5.118/25) angenommen. Das Dekret zielt darauf ab, die Finanzkrise des Landes zu mildern. Die Ölindustrie, der wichtigste Wirtschaftszweig Venezuelas, wurde nach der Verhängung von Zöllen durch die US-Regierung besonders hart getroffen.
Obwohl der wirtschaftliche Notstand zum Ziel hat, das Land zu stabilisieren, schafft sein weitreichender Geltungsbereich Rechtsunsicherheit für Unternehmen in Venezuela. Für ausländische Unternehmen, die in dem Land tätig sind, bestehen konkrete Risiken der Beschränkung von Gewinnüberweisungen, der direkten Intervention der Regierung in Handelsgeschäfte und der zwangsweisen Aufhebung von Verträgen sowie der vorübergehenden Verstaatlichung, was die Unvorhersehbarkeit der Geschäftstätigkeit erhöht.
Das verabschiedete Dekret gilt zunächst für 60 Tage ab seiner Veröffentlichung im Amtsblatt (Gaceta Oficial). Dieser Zeitraum kann gemäß den venezolanischen Gesetzen um weitere 60 Tage verlängert werden.
Venezuela befindet sich in einer Wirtschaftskrise, die seit den Präsidentschaftswahlen von 2024, deren Ergebnis bis heute nicht gemäß den Bestimmungen der venezolanischen Verfassung bestätigt wurde, weiter eskaliert ist.
Asien und Ozeanien
ASEAN / WIRTSCHAFT: ASEAN ist eine spannende Alternative für deutsche Firmen
Die Staatengemeinschaft gilt als eine dynamische Wirtschaftsregion, die vielfältige Möglichkeiten eröffnet. Ein Überblick über die Stärken – und Schwächen der Region.
Die Länder der ASEAN-Gemeinschaft (Association of Southeast Asian Nations) sind einer der großen Gewinner der Diversifizierungsstrategien internationaler Unternehmen. Südostasien liegt strategisch günstig abseits der großen Konfliktlinien und bietet sich somit als alternativer Investitions-, Absatz- und Beschaffungsmarkt zu China an. Die ausländischen Direktinvestitionen in ASEAN haben sich zwischen 2016 und 2023 mehr als verdoppelt und übertreffen mittlerweile die Investitionen nach China.
Für Deutschland ist die ASEAN-Region mit Lieferungen in Höhe von rund 30 Milliarden US-Dollar (US$) der zweitgrößte Absatzmarkt in Asien nach China. Noch bedeutender ist sie als Beschaffungsmarkt, vor allem für Elektronik- und Konsumgüter, aber auch für Rohstoffe wie zum Beispiel Nickel oder Bauxit. Deutschland importiert Waren im Wert von insgesamt rund 60 Milliarden US$ von dort. Schätzungen zufolge sind rund 5.000 deutsche Firmen in der Region aktiv.
Wachstumsmarkt ASEAN
Die ASEAN-Staaten bilden zusammen eine der wachstumsstärksten Regionen weltweit. Auch in den kommenden Jahren könnte die Wirtschaftsleistung real wieder um mehr als 5 Prozent pro Jahr steigen und damit stärker als in China. Im Zuge der US-Handelspolitik könnten diese Prognosen allerdings etwas nach unten korrigiert werden, da den ASEAN-Staaten unerwartet hohe Zölle auf Exporte in die USA drohen.
In der ASEAN-Region leben 670 Millionen Menschen und damit 1,5-mal so viele wie in der EU. Ihre Wirtschaftsleistung erreicht zusammengenommen etwa 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von China. Die größte Volkswirtschaft der Region ist Indonesien. Sie erwirtschaftet rund ein Drittel des gesamten BIP der Gemeinschaft und beheimatet rund 42 Prozent ihrer Bevölkerung. Allerdings fließen rund zwei Drittel der Direktinvestitionen nach Singapur.
Die relativ niedrigen Lohnkosten, mit Ausnahme von Singapur, machen die Region auch für arbeitsintensive Produktionsprozesse attraktiv. Darüber hinaus sind in Ländern wie Singapur, Malaysia oder den Philippinen die Englischkenntnisse der Bevölkerung sehr gut. Deutsche Unternehmen wie Bosch, B. Braun, BASF, Continental oder Infineon nutzen diese Vorteile und produzieren Erzeugnisse in Sektoren wie Medizintechnik, Kfz, Elektronik und Halbleiter in ASEAN.
Freihandelsabkommen lassen auf sich warten
In der Region herrscht allerdings ein zunehmender Fachkräftemangel. Zudem ist die Infrastruktur teilweise noch schwach aufgestellt. Es sind jedoch viele Modernisierungsprogramme und Großprojekte geplant, die auch deutschen Baufirmen Geschäftschancen bieten.
Mit Ausnahme Singapurs gilt die überbordende Bürokratie als weiterer Hemmschuh für geschäftliche Aktivitäten. Für ausländische Firmen ist es aufgrund stark ausgeprägter Netzwerke zum Teil sehr schwer, an die dominierenden Großkonglomerate heranzukommen. Dafür bedarf es meist langjähriger Aufbauarbeit vor Ort.
Die Abschlüsse von Freihandelsabkommen durch die EU verzögern sich. Bisher können deutsche Firmen in der Region erst von zwei Abkommen profitieren. Sie wurden mit Singapur und Vietnam geschlossen. Zuletzt hat die EU die Verhandlungen mit Thailand, Malaysia und den Philippinen wieder aufgenommen.
Geringer Integrationsgrad innerhalb der ASEAN-Staaten
Deutsche Produkte stehen zunehmend in Konkurrenz zu chinesischen Waren. Unternehmen aus China drängen immer stärker nach Südostasien. Grund dafür sind die nachlassende Wirtschaftsdynamik und Überkapazitäten im Heimatmarkt. Wegen der Zollerhöhungen durch die Trump-Administration in den USA wird befürchtet, dass noch mehr Produkte aus China nach ASEAN geliefert werden und somit den Wettbewerbsdruck weiter erhöhen.
Um sich gegenüber externen Unsicherheiten widerstandsfähiger zu machen, wollen die ASEAN-Staaten den intraregionalen Handel und die Investitionen innerhalb der ASEAN stärken. Derzeit werden nur 20 Prozent der Güter innerhalb der ASEAN-Staaten gehandelt. Zum Vergleich: In der EU sind es 60 Prozent. Darüber hinaus könnte auch die schon seit Längerem angestrebte Modernisierung der Industrie vorangetrieben und die Wertschöpfung in ASEAN erhöht werden. Ebenso wollen die Staaten im Zuge der US-Handelspolitik die Handelsbeziehungen mit Drittstaaten intensivieren, um unabhängiger von den USA und China zu werden.
Doch diese Ziele sind nicht einfach zu erreichen. Denn die ASEAN-Staaten haben weder ein gemeinsames Parlament noch einen Gerichtshof, geschweige denn eine gemeinsame Währung. Wirtschaftspolitische Entscheidungen sind daher – auch wegen der sehr unterschiedlichen Regierungsformen – nur schwer durchsetzbar.
Strategisch günstige Lage als Pluspunkt
Ein wichtiger Vorteil von ASEAN ist die strategisch günstige Lage. Südostasien und insbesondere Singapur gelten als wichtiger globaler Logistikhub. Von den 20 größten Häfen weltweit finden sich 4 in der Region. Von dort aus können die großen regionalen Wirtschaftsmächte China, Japan und Südkorea einfach bedient werden. Und im Falle eskalierender Konflikte, etwa zwischen Taiwan und China, wäre die Region von Europa aus auf dem Seeweg weiterhin erreichbar.
Die ASEAN-Volkswirtschaften weisen ein breites Spektrum an Entwicklungsstadien auf: angefangen von der Industrienation Singapur über aufstrebende Märkte und rohstoffreichen Staaten bis hin zu Entwicklungsländern wie Laos, Kambodscha oder Myanmar. Darüber hinaus finden interessierte Unternehmen unterschiedliche Branchenschwerpunkte in den Mitgliedstaaten vor.
In Singapur dominieren Dienstleistungen, Forschung und Entwicklung sowie Hightechindustrien wie etwa Biotechnologie oder Halbleiter. Im Bereich Chips, Elektronik und Datenzentren hat sich Malaysia als attraktiver Standort etabliert, in Teilen auch die Philippinen und Thailand. In Letzterem findet sich darüber hinaus eine breite Palette an Kfz-Herstellern. Kambodscha fungiert als Standort für die Bekleidungsindustrie. Und Vietnam zog in den vergangenen Jahren zahlreiche internationale Industriefirmen an.
Die Philippinen sind dagegen ein global wichtiger Akteur im Bereich BPM-Dienstleistungen (Business Process Management). Indonesien verfügt über Rohstoffe wie Kohle, Nickel und Stahl, und Laos gilt mit seinem großen Potenzial für Wasserkraft als die „Batterie Südostasiens„.
BANGLADESCH / INDUSTRIE: In Bangladesch herrscht Aufbruchstimmung
Bangladeschs Übergangsregierung setzt auf Förderung der verarbeitenden Industrie, ausländische Direktinvestitionen und den Abbau von Bürokratie, um die Wirtschaft zu stärken.
Beim „Bangladesh Investment Summit“ Anfang April 2025 wurde einmal mehr deutlich, dass die dringend nötige Entwicklung der Wirtschaft nur mit einer funktionierenden verarbeitenden Industrie erreichbar ist. Bereits 2022 wollte die damalige Regierung die Industriebasis verbreitern, was jedoch bislang nur in Ansätzen gelungen ist. Der Dringlichkeit dieses Vorhabens ist sich auch die aktuelle Übergangsregierung des Landes bewusst.
Um die verarbeitende Industrie zu fördern, öffnet Bangladesch sich massiv für ausländische Direktinvestitionen und fördert diese auch entsprechend. Die bangladeschische Investitionsfördergesellschaft BIDA (Bangladesh Investment Development Authority) hat eine Übersicht veröffentlicht, in der alle Investitionsanreize für Niederlassungen in den fünf Freihandelszonen aufgezeigt sind.
Das Land kann bereits einige erfolgreiche Cluster vorweisen, allen voran in der wirtschaftlich enorm wichtigen Textilindustrie. Aber auch in der Elektroindustrie gibt es bereits Unternehmen, die auf Weltniveau produzieren.
Laut Weltbank lag 2023 der Anteil der Industrie am bangladeschischen Bruttoinlandsprodukt bei etwa 35 Prozent. Zum Vergleich: In Indien trug der Sektor 2023 rund 25 Prozent zur Wirtschaftsleistung bei, in China 38 Prozent.
Deutsche Maschinen für den Industrieausbau
Die für den Ausbau der verarbeitenden Industrie nötigen Maschinen und Anlagen bezieht Bangladesch oft aus dem Ausland. Sheikh Bashir Uddin, amtierender Handelsminister, sagte im Gespräch mit Germany Trade and Invest: „Wenn man das Preis-Leistungs-Verhältnis betrachtet, gibt es für mich zu deutschen Maschinen keine Alternative. Sie mögen zwar auf den ersten Blick teuer erscheinen, amortisieren sich aber durch ihre Langlebigkeit und geringe Reparaturanfälligkeit und sind somit Konkurrenzprodukten sehr häufig auch preislich überlegen.“
Thomas Köning, CEO des Bekleidungsherstellers Ospig aus Bremen, produziert bereits seit 30 Jahren in Bangladesch. Die Firma wird in den nächsten zwölf Monaten weitere Investitionen im Land tätigen. Der Austausch der in die Jahre gekommenen industriellen Waschmaschinen steht dabei ganz oben auf der Liste. Er ist der Meinung:
„Bangladesch ist auf einem guten Weg.“
Trotz der politischen Turbulenzen in Bangladesch legte der bilaterale Handel zwischen dem südasiatischen Land und Deutschland von 8,7 Milliarden US-Dollar (US$) im Jahr 2023 auf 9,8 Milliarden US$ im Jahr 2024 zu. Alleine die deutschen Einfuhren von Bekleidung und Zubehör aus Bangladesch stiegen um fast 435 Millionen US$. Textilien und Bekleidung machen über 90 Prozent der Gesamtimporte Deutschlands aus dem südasiatischen Land aus.
Bei den deutschen Lieferungen nach Bangladesch dominieren Maschinen und Anlagen. Ihr Anteil an den deutschen Exporten lag 2024 bei über 43 Prozent. Weitere Zahlen zum Außenhandel finden Sie in unseren Wirtschaftsdaten kompakt.
Tiefseehafen ist dringend erforderlich
Das größte Potenzial für Bangladesch sieht Köning im klaren Willen der Übergangsregierung, Probleme beseitigen zu wollen. Dazu gehören neben dem Abbau der Bürokratie vor allem der Ausbau der Infrastruktur. So braucht ein Lkw für die rund 270 Kilometer von Dhaka zum Hafen in Chattogram (Chittagong) derzeit zehn Stunden. „Das ist entschieden zu lang“, so Köning.
Der sich schon länger in der Planungs- und Bauphase befindliche Tiefseehafen in Matarbari ist nach Überzeugung des Unternehmers dringend erforderlich. Denn der Hafen in Chattogram, über den knapp 70 Prozent des Ex- und Imports laufen, ist nur ein Flusshafen. Schiffe mit einem Tiefgang von mehr als 9,5 Metern können hier nicht andocken.
Die Mehrheit der Güter wird momentan von Chattogram über Colombo in Sri Lanka, Port Klang oder Tanjung Pelepas (beide in Malaysia) oder den Hafen in Singapur verschifft. Hier werden die Waren dann auf größere Schiffe umgeladen. Das ist ein zeitraubendes Unterfangen. Mit einem Tiefseehafen in Bangladesch ließe sich die Lieferzeit beispielsweise nach Hamburg von derzeit über 40 Tagen auf 15 bis 20 Tage verkürzen.
Für Jugendliche gibt es zu wenig Arbeit
Ein weiterer Vorteil für die verarbeitende Industrie des Landes ist das immense Humankapital. Allerdings muss Bangladesch jedes Jahr zwischen 2 Millionen und 2,5 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen, um die neu auf den Arbeitsmarkt strömenden Nachwuchskräfte zu versorgen. Das ist selbst mit einem gut ausgebauten industriellen Sektor eine große Herausforderung.
Von den jährlich rund 650.000 Hochschulabsolventen finden nur knapp die Hälfte in den ersten zwei Jahren eine Anstellung. Die Lehrpläne an bangladeschischen Hochschulen decken sich oft nicht mit den Bedürfnissen der Industrie. Der Fachkräftemangel ist deutlich und Unternehmen wünschen sich eine praxisorientiertere Ausbildung.
Die Jugendarbeitslosigkeit ist ein Problem: Anfang 2025 lag sie nach Angaben der International Labour Organization bei 16,8 Prozent. Etwa 31 Prozent der bangladeschischen Jugendlichen sind weder erwerbstätig noch in (schulischer) Ausbildung, über zwei Drittel davon sind Mädchen und junge Frauen.
CHINA / AUSSENHANDEL: Neue Negativliste für den Marktzugang in China
China hat im April 2025 eine aktualisierte, erneut kürzere Fassung der sogenannten Marktzugangsnegativliste veröffentlicht. Sie ersetzt die bisherige Version aus dem Jahr 2022.
Chinas National Development and Reform Commission (NDRC), die State Administration for Market Regulation (SAMR) und das Ministry of Commerce (MOFCOM) haben eine neue Fassung der Marktzugangsnegativliste (Negative List for Market Access) herausgegeben.
Diese gilt für aus- und inländische private Investitionen und führt in der neuen Version 106 Punkte in 21 Abschnitten (Industriesektoren) auf, davon sechs verbotene Bereiche (Einzelheiten im Anhang der Liste mit nunmehr 153 Gegenständen).
Die neue Liste ersetzt die bisherige Fassung aus März 2022, die noch 117 Posten (sechs Verbote, 111 Beschränkungen) enthielt. Während einzelne Gegenstände innerhalb der gelisteten Sektoren wegfallen, werden allerdings auch verschiedene neue Beschränkungen in Teil 2 hinzugefügt, unter anderem beim Onlineverkauf von Arzneimitteln (Abschnitt 20, Ziff. 100) oder im Bereich des Betriebs ziviler Drohnen (Abschnitt 7, Ziff. 49).
Die Negativlisten verbieten oder beschränken Investitionen in bestimmten Branchen. In beschränkten Industrien ist ein Tätigwerden nur unter bestimmten Bedingungen (etwa Genehmigungsvorgaben) erlaubt. Ausländische Investoren haben zudem im ersten Schritt die Negativlisten für ausländische Investitionen zu beachten.
CHINA / CHEMIE: Chinas Chemiebranche zwischen Quantität und Qualität
In der Chemieindustrie in China drücken Überkapazitäten auf die Preise. Gleichzeitig müssen Produzenten für mehr Nachhaltigkeit neue Herstellungsprozesse und Produkte entwickeln.
Ausblick auf die chemische Industrie in China
- Krise des Immobiliensektors setzt sich fort.
- Gesamtkonjunktur bleibt schwach.
- Überkapazitäten intensivieren Preiswettbewerb.
- Nachfrage nach klimafreundlicheren Produkten steigt.
Zu den Markttrends, Branchenstruktur und Nachhaltigkeit im Einzelnen: Chemische Industrie China
CHINA / ZÖLLE: China erhebt Antidumpingzölle auf Polyoxymethylen-Copolymere
Seit dem 19. Mai 2025 sind bei der Einfuhr nach China Antidumpingzölle zu zahlen.
Bei der Einfuhr von Polyoxymethylen-Copolymeren der chinesischen Zolltarifnummern 3907.1010 und 3907.1090 mit Ursprung in den USA, der EU, Taiwan und Japan sind ab dem 19. Mai 2025 zum Teil hohe Antidumpingzölle zu zahlen:
- Für Waren mit Ursprung in den USA gilt ein Antidumpingzollsatz von 74,9 Prozent,
- Für Waren mit Ursprung in der EU gilt ein Antidumpingzollsatz von 34,5 Prozent.
- Auf Waren mit Ursprung in Taiwan gelten für zwei bestimmte Hersteller Zollsätze von 3,8 und 4,0 Prozent, im Übrigen 32,6 Prozent.
- Für Waren mit Ursprung in Japan gilt für einen bestimmten Hersteller ein Zollsatz von 24,5 Prozent, im Übrigen 35,5 Prozent.
Details ergeben sich aus der Bekanntmachung des chinesischen Wirtschaftsministeriums vom 18. Mai 2025 (nur Chinesisch).
INDONESIEN / ZOLL: Indonesien kämen US-Extra-Zölle zur Unzeit, Deutschland könnte profitieren
Indonesien will zusätzliche Handelsbarrieren unbedingt vermeiden und kommt den USA entgegen. Davon könnten auch deutsche Firmen profitieren.
Südostasiens größte Volkswirtschaft Indonesien hat mit den USA einen größeren Handelsbilanzüberschuss. Mit 19 Milliarden US-Dollar (US$) liegt dieser jedoch weit unter dem von Vietnam oder Thailand. Und doch steht Indonesien mit den geplanten US-Sonderzöllen von 32 Prozent innerhalb der ASEAN relativ weit oben auf der Liste der Trump-Regierung. Angesichts eines ohnehin schwachen Konsums, knapper Haushaltsmittel und einer schleppenden industriellen Entwicklung würden die angedrohten Zölle die indonesische Volkswirtschaft zusätzlich treffen.

Von Zugeständnissen an die USA könnten auch deutsche Firmen profitieren
Das will die Regierung des südostasiatischen Staates verhindern. Nach Veröffentlichung von Trumps Zolltabelle reiste eine hochrangige Delegation aus Jakarta nach Washington und bot den USA unter anderem an: US-Firmen könnten exklusive Zollsenkungen erhalten. Zudem will Indonesien mehr Öl, Gas, Weizen, Soja und Bergbauequipment aus den USA importieren.
Außerdem werde der indonesisch-stämmige Mischkonzern Indorama Corporation 2 Milliarden US-Dollar in ein Ammoniakwerk im US-Bundesstaat Louisiana investieren, das dann die Düngemittelindustrie in Indonesien beliefern und den Handelsbilanzüberschuss Indonesiens abbauen könnte. Teil des Deals könnte auch der Export von indonesischem Nickel in die USA sein, deren Ausfuhren noch verboten sind.
Interessant aus deutscher Sicht ist, dass Indonesien erwägt, nicht tarifäre Handelshemmnisse abzubauen, und zwar für alle ausländischen Unternehmen. Dazu gehören die berüchtigten Anforderungen an einen Mindestanteil lokaler Produktion, zum Beispiel bei staatlichen Beschaffungsausschreibungen. Diese werden von den USA besonders kritisiert.
Indonesien exportiert Konsumgüter und elektronische Komponenten in die USA
Die USA sind für Indonesien nach China der zweitgrößte Absatzmarkt und ein wichtiger Abnehmer für die wenigen Industrieprodukte, bei denen Indonesien international wettbewerbsfähig ist. Indonesiens Exporte in die USA bestehen hauptsächlich aus günstig produzierten Konsumgütern wie Kleidung und Schuhen. Darüber hinaus exportiert das Land Möbel, Autoreifen und Palmöl in die USA, ferner Elektrokomponenten wie Netzwerktechnik und elektrische Industrieausrüstung wie Kontrollpanels.
US-Amerikanische Zollerhöhungen auf diese Waren würden die Nachfrage und damit auch Indonesiens Wirtschaftswachstum schmälern, das durch den schwächelnden Privatkonsum zurzeit ohnehin schon weit von angestrebten Wachstumsraten entfernt ist. Die Regierung möchte 2029 eigentlich ein Plus von 8 Prozent erreichen, ausgehend von 5 Prozent im Jahr 2024.
Auch könnte ein Handelskonflikt mit den USA dem Land einen Strich durch die Rechnung machen, künftig Batterien für E-Autos in die USA zu liefern. Indonesien baut hier gerade eigene Wertschöpfungsketten auf.
US-Zölle auf China mit indirekten Folgen
Nicht nur die Zölle auf indonesische Waren bereiten Sorgen, sondern auch die auf die chinesischen Lieferungen in die USA. Zum Beispiel könnte die chinesische Nachfrage nach dem Edelstahlvorprodukt Ferronickel sinken. Die indonesischen Ferronickel-Lieferungen nach China beliefen sich 2023 auf rund 15 Milliarden US$. Der Rohstoff wird in China weiterverarbeitet und die Ferronickel-Produkte werden nicht zuletzt in die USA exportiert.
Auch könnte China Indonesien mit Billiggütern überfluten. Schon jetzt ist beispielsweise die indonesische Textilindustrie durch chinesische Einfuhren existenzbedroht.
Ein Risiko droht auch für die Währung. Auch deutschen Unternehmen wird empfohlen, sich mit geeigneten Instrumenten gegen Wechselkursschwankungen abzusichern. Schon jetzt fließt angesichts der unsicheren globalen Lage Kapital aus Indonesien ab, und die Rupiah hat entsprechend abgewertet. Um sich vor ungewollten und unberechenbaren Schwankungen des US-Dollar-Wechselkurses abzusichern, könnten im Handel mit den neun anderen ASEAN-Partnern sowie mit China und Indien, mehr lokale Währungen zum Einsatz kommen.
Regierung könnte Anreize für ausländische Firmen erhöhen
Hohe US-Zölle auf chinesische Importe eröffnen aber auch die Chance, Indonesien mit seinem großen Markt und Rohstoffreichtum als alternativen Investitionsstandort zu China zu positionieren. Falls US-Firmen, die 2024 der viertgrößte Auslandsinvestor in Indonesien waren, ihr Kapital künftig eher in den USA investieren, müsste die indonesische Regierung für Unternehmen aus anderen Ländern besser Anreize schaffen, um im Land zu investieren.
Viele ausländische Firmen bezeichnen das Investitionsumfeld in Indonesien als herausfordernd. Es fehle unter anderem an hochwertigen Lieferketten und an qualifizierten Arbeitskräften. Zudem bestehen Lücken in der Infrastruktur und das Geschäftsumfeld gilt als überreguliert.
Dennoch haben sich in der jüngeren Vergangenheit ausländische und auch deutsche Firmen für den Aufbau von Produktionen entschieden. Wertmäßig liegen die ausländischen Direktinvestitionen im 1. Quartal 2025 auf dem ehrgeizigen Kurs der Regierung, auch wenn mit der koreanischen LG ein wichtiger Investor ein Großprojekt absagte.
Die Suche nach neuen Partnern könnte auch den Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union den nötigen Schub geben. Von dem Abkommen dürften deutsche Unternehmen deutlich profitieren. Aus Diplomatenkreisen hieß es Anfang Mai, das Abkommen habe nun gute Chancen, noch 2025 abgeschlossen zu werden.
JAPAN / STAHLINDUSTRIE: Japan fördert klimafreundlichere Stahlherstellung
JFE Steel setzt mithilfe der Regierung auf eine klimafreundlichere Stahlproduktion. Gleichzeitig expandieren Japans Stahlhersteller im Ausland.
Japans zweitgrößter Stahlhersteller JFE Steel will in Kurashiki in der Präfektur Okayama einen großen Elektrolichtbogenofen installieren. Dieser soll im 2. Quartal 2028 in Betrieb gehen. In Elektrolichtbogenöfen kann recycelter Stahlschrott eingeschmolzen werden. Sie werden zudem nicht mit Kohle, sondern mit Strom befeuert und gelten daher als umweltfreundlicher als konventionelle Anlagen. Die neue JFE-Anlage soll eine Kapazität von etwa zwei Millionen Tonnen Stahl pro Jahr haben. Das gab das Unternehmen am 10. April 2025 bekannt. Zu dem Vorhaben zählen auch Nebenanlagen, wie etwa ein modernisierter Kai. JFE Steel plant, insgesamt 2,2 Milliarden US-Dollar (US$) in das Projekt zu investieren. Japans Regierung fördert den klimafreundlichen Umbau der heimischen Stahlindustrie und subventioniert das Projekt von JFE Steel mit einem knappen Drittel der veranschlagten Kosten.
Großvorhaben auch bei Nippon Steel
Neben JFE Steel hatte sich auch Japans größter Stahlhersteller Nippon Steel für die staatliche Förderung zur klimafreundlichen Umstellung der Produktionsprozesse in der Stahlindustrie beworben. Der Konzern war aber bei der Ausschreibung nicht zum Zug gekommen. Bis zum 30. April 2025 lief eine weitere Ausschreibung der Regierung. Nippon Steel hat sich auch hierauf beworben.
In Nagoya treibt Nippon Steel ein weiteres Großprojekt voran. Hier baut der Stahlkocher eine Warmwalzanlage der nächsten Generation. Die Anlage mit einer geplanten Kapazität von 6 Millionen Tonnen pro Jahr ist seit Mai 2022 in Bau und soll im 2. Quartal 2026 fertiggestellt werden. Die neue Anlage soll 1,8 Milliarden US$ kosten und ein bestehendes Walzwerk ersetzen.
Stahlproduktion im Inland rückläufig
Die Stahlproduktion fällt in Japan schon seit Jahren, zuletzt im Kalenderjahr 2024, um circa 3 Prozent. Dabei erzeugte Nippon Steel im Fiskaljahr 2023 (von April 2023 bis März 2024) 40,5 Millionen Tonnen Rohstahl. JFE Steel produzierte 24,8 Millionen Tonnen. Kobe Steel belegte mit 5,97 Millionen Tonnen in Japan Rang 3. Im Jahr 2024 wurden in Japan laut der Japan Iron and Steel Federation insgesamt 22,1 Millionen Tonnen Roheisen in Elektrolichtbogenöfen hergestellt. Bisher betreiben in Japan folgende Firmen Elektrolichtbogenöfen: Tokyo Steel, Kyoei Steel, Japan Steel Works, Godo Steel, Nakayama Steel Works, Yamato Kogyo, Osaka Steel und Tokyo Tekko.
Japans Stahlkocher expandieren in Indien
Japan ist nach China und Indien der drittgrößte Stahlerzeuger weltweit. Während die Stahlerzeugung in der EU und in anderen Industrieländern sowie auch in Japan sinkt, steigt sie in Indien deutlich. Vor diesem Hintergrund übernahm JFE Steel Anfang 2025 zusammen mit dem indischen Stahlhersteller JSW Steel für circa 440 Millionen Euro die thyssenkrupp Electrical Steel India. Zuvor hatten JFE Steel und JSW Steel im Februar 2024 das Joint Venture JSW JFE Electrical Steel gegründet. Dieses will mit einer Investition von 670 Millionen US$ in Bellary im Bundesstaat Karnataka in Indien ein Werk für Elektrostahlblech errichten. Die Massenproduktion soll dort im Fiskaljahr 2027 beginnen. JFE Steel hält seit 2012 eine 15-prozentige Beteiligung an JSW Steel.
Nippon Steel investiert ebenfalls in Indien. ArcelorMittal Nippon Steel India, an dem Nippon Steel mit 40 Prozent beteiligt ist, kündigte im März 2025 den Kauf eines Grundstücks in Anakapalli im Bundesstaat Andhra Pradesh an. Dort will das Unternehmen ein Stahlwerk mit einer Kapazität von zunächst 7 Millionen Tonnen Rohstahl errichten. In den USA hatte Nippon Steel im Dezember 2023 für die Übernahme von US Steel 14,1 Milliarden US$ geboten, stößt aber bisher auf Widerstand aus der US-Regierung.
Nippon Steel und JFE Steel investieren in australische Kohlemine
Die Stahlherstellung wird auch weiterhin auf traditionelle Rohstoffe wie Kohle zurückgreifen. Um sich diese zu sichern, haben sich Nippon Steel und JFE Steel Anfang 2025 mit zusammen 30 Prozent an der Blackwater-Kohlemine im Bundesstaat Queensland in Australien beteiligt. Hierfür investierte Nippon Steel 720 Millionen US$ und JFE Steel 360 Millionen US$. Für den Erwerb des Anteils von JFE Steel an der Kohlemine stellte die staatliche Japan Bank for International Cooperation zusammen mit drei japanischen Großbanken einen Kredit zur Verfügung.
Auswirkungen der US-Zölle bisher überschaubar
Die am 11. Februar 2025 angekündigten und seit dem 12. März geltenden Importzölle der USA für Stahleinfuhren in Höhe von 25 Prozent machen die Lage für Japans Stahlkocher nicht einfacher. Die Menge an Stahl, die Japan in die USA exportiert, fiel daraufhin im Februar 2025 um 13,7 Prozent und im März 2025 um 15,7 Prozent gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres. Allerdings nahmen die USA 2024 lediglich 3,6 Prozent der japanischen Stahlexporte in Höhe von weltweit 31,4 Millionen Tonnen ab. Daher fallen mögliche Auswirkungen von US-Zöllen auf die Produktion wichtiger Abnehmerbranchen von Stahl in Japan deutlich schwerer ins Gewicht als die auf die direkten Stahlexporte in die USA. Die Hauptabnehmerbranchen von Stahl im Inland sind die Baubranche, die Kfz-Industrie und der Schiffbau.
Höhere US-Zölle auf Stahl führen tendenziell zu sinkenden Stahlpreisen auf den Weltmärkten. Dies schiebt den Wettbewerb auf Drittmärkten, wie etwa in Südostasien an. Zum einen dürften Japans Konkurrenten wie China oder Südkorea mehr Stahl in die Region liefern. Zum anderen könnten Südkorea und China weniger Stahl aus Japan kaufen. Dadurch dürften japanische Stahlanbieter unter stärkerem Wettbewerb auf Drittmärkten stehen, zum Beispiel in Südostasien.
MALAYSIA / AUFENTHALTSRECHT: Neues Investorenvisum in Malaysia
Ausländische Investoren können seit 1. April 2025 in Malaysia den sogenannten Investor Pass beantragen. Dieser ist nicht auf bestimmte Sektoren beschränkt.
Inhaber dieses speziellen Visums sollen Investitionsvorhaben in unterschiedlichen Bereichen vorantreiben können (abhängig vom Sektor sind allerdings eventuell weitere Lizenzen einzuholen) und können insbesondere gegebenenfalls Investitionsanreize wie Steuerbefreiungen in Anspruch nehmen.
Der entsprechende Antrag auf einen Investor Pass ist zunächst bei der malaysischen Investitionsförderbehörde MIDA (Malaysian Investment Development Authority) über die Online-Plattform Xpats Gateway nebst verschiedenen Nachweisen einzureichen. Gegebenenfalls sind Übersetzungen von Dokumenten, die nicht auf Englisch vorliegen, erforderlich. Mindestinvestitionsvorgaben gibt es im Zusammenhang mit dem Investor Pass nicht.
Besteht der Antrag die Beurteilung durch die MIDA, wird ein Schreiben („MIDA support letter“) ausgestellt, das als Voraussetzung der finalen Überprüfung durch die Einwanderungsbehörde (Immigration Department of Malaysia, Expatriate Services Division (ESD)) dient. Erst nach deren Genehmigung wird schließlich der Investor Pass ausgestellt.
Die Gültigkeit des Investorenvisums beträgt zunächst sechs Monate, nach Verlängerung bis zu maximal zwölf Monate, mit mehrmaliger Einreisemöglichkeit.
OSTASIEN / DATENZENTREN: In Ostasien entstehen über 2.000 neue Rechenzentren
Der Bau von Rechenzentren für KI- und Cloud-Anwendungen boomt in Ostasien. Daraus ergeben sich auch viele Projektaussichten für deutsche Ausrüstungsanbieter.
China, Japan, Südkorea und Taiwan investieren kräftig in neue Datenzentren. Die Einführung und Nutzung von künstlicher Intelligenz und Cloud-Anwendungen lässt den Bedarf an Hochleistungsrechenzentren steigen. Weit über 2.000 neue Datenzentren werden bis 2030 in Ostasien entstehen und ältere modernisiert. Deutsche Firmen sind dabei gefragte Anbieter.
Wo neue Rechenzentren entstehen oder bestehende modernisiert werden, ist Kühlung unverzichtbar – und deutsche Unternehmen wie Stulz und Cloud&Heat Technologies sind meist mit dabei. Auch andere deutsche Firmen mischen in der Branche mit: Siemens sorgt für die Energieversorgung, Rittal liefert die Infrastruktur, und Exyte begleitet Projekte von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe.
Ostasiatische Länder investieren Milliarden in neue Rechenzentren
Chinas Planwirtschaft treibt den Ausbau der Rechenzentren rasant voran – als Rückgrat für 5G, E-Commerce und künstliche Intelligenz. Derzeit sind rund 347 Großprojekte genehmigt, mit Investitionen von etwa 39 Milliarden US-Dollar. Bis 2030 soll die Zahl neuer Projekte auf über 500 und die Investitionshöhe auf über 77 Milliarden US$ zulegen. Die schiere Größe Chinas macht die Verteilung von Rechenzentren notwendig.
In Südkorea soll die Zahl der Rechenzentrenstandorte von 153 Ende 2023 auf 732 bis 2029 steigen. Dabei soll in Südkorea bis 2028 für 35 Milliarden US$ eines der größten Datenzentren weltweit entstehen. Der Bau erfolgt außerhalb des Großraums Seoul, da die Regierung die starke Ballung in der Hauptstadtregion entzerren will.
Japan setzt ebenfalls auf Dezentralisierung. Dort hat sich der Bau von Rechenzentren bislang auf die Großräume Tokyo und Osaka konzentriert. Im Archipel gab es Ende 2023 laut der japanischen „Expertengruppe für digitale Infrastruktur“ landesweit 510 Rechenzentren. Konkrete Ausbauzahlen liegen nicht vor, jedoch sind weitere ausländische Investitionen in Rechenzentren willkommen.
Auch Taiwans Regierung will den Neubau von Rechenzentren im Raum Taipei einschränken. Mit 22 fertiggestellten Rechenzentren Ende 2024 ist Taiwans Infrastruktur noch ausbaufähig, insbesondere im energiereicheren Süden und Westteil der Insel. Microsoft errichtet gegenwärtig Datenzentren im nordwestlichen Taoyuan. Die deutsche Firma Exyte kommt dabei als einer der beiden Kontraktoren zum Einsatz.
Strombedarf unterschätzt
Datenmengen steigen und mit ihnen der Energiebedarf digitaler Infrastrukturen. Wie schnell die Anforderungen wachsen, hängt unter anderem von der weiteren Entwicklung von KI-Modellen sowie deren Konfiguration und Anwendung ab. Langfristprognosen sind daher unsicher. Laut IEA soll die Stromnachfrage durch Rechenzentren bis 2030 weltweit auf 945 Terawattstunden steigen.
Allein China rechnet bis 2030 mit einem Stromverbrauch von 530 Terawattstunden für seine Rechenzentren. Auch in den USA dürfte der Energiebedarf weiter steigen, wenn Cloud- und Streaming-Anbieter ihr Wachstumstempo beibehalten. Hinzu kommen massive Investitionen in KI-Rechenzentren in Ländern wie Japan, Südkorea, Taiwan und in Südostasien. Laut der Marktforschungsfirma Insight Partners soll der weltweite Bedarf an Rechenzentrums-Ausrüstung von 243 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf rund 670 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 anwachsen.
China und Taiwan setzen stärker auf erneuerbare Energien
Energieeffizienz und grüne Stromversorgung sind wichtige Ziele in fast allen ostasiatischen Märkten. Dabei ist China weit fortgeschritten: Landesweit gab es 2024 bereits 246 grüne Rechenzentren mit einem Nutzungsanteil erneuerbarer Energieträger von 50 Prozent. Die Vorgabe für den Neubau von Datenzentren ab 2025 ist ein Anteil von mindestens 80 Prozent grüner Energie.
In Taiwan verfolgt Chunghwa Telecom das Ziel, den Anteil grüner Energie von 35 Prozent im Jahr 2024 auf 100 Prozent bis 2030 zu steigern. Auch internationale Anbieter mit Rechenzentren im Land dürften sich an diesem Ziel orientieren. Allerdings ist der Wettbewerb um grüne Energie intensiv – denn laut Chunghwa Telecom wächst das Angebot bei weitem nicht so schnell wie der steigende Strombedarf.
Südkorea und Japan hinken bei Ökostrom hinterher
In Südkorea lag der Anteil erneuerbarer Energien an der Versorgung von Rechenzentren im Jahr 2022 gerade mal bei 1,9 Prozent. Nachhaltigkeit spielt beim Ausbau bislang eine untergeordnete Rolle. Zwischen 2024 und 2030 soll die IT-Leistung von Rechenzentren von 1.200 auf 3.300 Megawatt steigen. Dies spiegelt sich auch im Stromverbrauch wider, der im gleichen Zeitraum von 8,2 Terawattstunden auf 18 Terawattstunden zunehmen soll.
Japans Regierung will bis 2040 alle Rechenzentren klimaneutral betreiben. Der Energieverbrauch der Rechenzentren soll dabei zwischen 2024 und 2030 um das Zehnfache steigen – auf rund 4.400 Megawatt. Vor allem US-amerikanische Firmen investieren umfangreich in die Datenzentreninfrastruktur in Japan.
Investitionskosten für Rechenzentren steigen
In den kommenden Jahren werden die Kosten für Grundstücke sowie den Bau und die Ausstattung von Rechenzentren in Ostasien deutlich steigen. Gründe sind die hohe Nachfrage nach Bauleistungen und gestiegene Materialpreise. Laut der Marktforschungsfirma IDC sind die Investitionskosten in Japan bereits um das 1,5-Fache gestiegen.
Aus Gründen der Souveränität, Sicherheit und des Datenschutzes strebt jedes Land ein möglichst eigenständiges digitales Ökosystem an. Während Japan, Südkorea und Taiwan ihre Märkte für ausländische Cloud-Anbieter und spezialisierte Rechenzentrumsentwickler geöffnet haben, ist der Zugang in China bislang stark eingeschränkt. Dort waren bisher nur Joint Ventures mit chinesischen Partnern erlaubt. Seit Oktober 2024 dürfen in vier Pilotstädten erstmals auch vollständig ausländisch betriebene Rechenzentren entstehen.
PHILIPPINEN / STEUERRECHT: Neue Steuerpflichten für digitale Dienstleistungen
Seit dem 2. Juni 2025 gelten neue Vorschriften für die Mehrwertsteuer auf digitale Dienstleistungen, die von ausländischen Unternehmen erbracht werden.
Am 2. April 2025 hat die philippinische Steuerbehörde (Bureau of Internal Revenue – BIR) die Revenue Regulation No. 14-2025 erlassen. Dieses Rechtsinstrument legt neue Mehrwertsteuerpflichten für ausländische Unternehmen fest, die digitale Dienstleistungen für Kunden im Land anbieten.
Gemäß der neuen Regelung müssen sich alle nicht ansässigen Anbieter digitaler Dienstleistungen (Non-Resident Digital Service Providers – NRDSP) bis zum 1. Juni 2025 über das sogenannte VDS-Portal oder das Online-Registrierungs- und Aktualisierungssystem (Online Registration and Update System – ORUS) elektronisch beim BIR registrieren. Konkret zielt die neue Regelung darauf ab, die Steuerpflichten für ausländische digitale Plattformen, die auf dem philippinischen Markt tätig sind, zu vereinheitlichen.
Während der Übergangsphase kann die Steuerbehörde bei Bedarf die Fristen für ausländische Unternehmen verlängern, um ihre Situation beim BIR zu klären. In jedem Fall werden ab dem 2. Juni 2025 alle Leistungen im Zusammenhang mit der Erbringung digitaler Dienstleistungen, die von ausländischen Unternehmen durchgeführt werden, der philippinischen Mehrwertsteuer unterliegen.
VIETNAM / BAUWIRTSCHAFT: Vietnamesische Bauwirtschaft erlebt Aufschwung auf breiter Front
Die Erholung im Wohnungsbau in Vietnam nimmt Fahrt auf. Industrie- und Infrastrukturbau entwickeln sich weiter gut. (Stand: März 2025)
Ausblick der Bauwirtschaft in Vietnam
- Der Wohnungsbau wird sich 2025 langsam wieder erholen. Die Situation der Bauunternehmen und der Baustoffindustrie ist zum Teil weiter kritisch.
- Industrie- und Infrastrukturbau laufen weiterhin gut. Investoren bauen Fabriken und der Autobahnausbau schreitet voran.
- Die Erholung im Hochbau könnte ab Mitte 2025 Fahrt aufnehmen. Dies könnte mehr finanziellen Raum schaffen für Investitionen in Modernisierung und Nachhaltigkeit.
- Im Baustoffsektor gibt es weiter hohe Überkapazitäten und mehr Konkurrenz durch Importe.
Zu den Entwicklungen in den einzelnen Bereichen (Hochbau, Tiefbau, Zulieferprodukte, Wettbewerb und Geschäftspraxis): Bauwirtschaft Vietnam
VIETNAM / ENERGIE: Vietnam will den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen
Für einen stärkeren Ausbau der Energieerzeugung hat Vietnam den Rechtsrahmen angepasst. Das Land hofft, dass dadurch eine neue Investitionswelle beginnt.
Die vietnamesische Regierung hat am 15. April 2025 eine angepasste Version ihres Ausbauplans für den Energiesektor (Power Development Plan 8; PDP8) verabschiedet. Der ursprüngliche Plan wurde im Mai 2023 veröffentlicht. PDP8 ist sowohl ein Schlüsseldokument für die Ausrichtung des Strommixes im Land bis 2030 beziehungsweise 2050 als auch für den Ausbau der Stromkapazitäten und der Leitungsnetze. Nur Vorhaben, die im PDP8 verzeichnet sind, haben eine Aussicht auf Umsetzung.
Die Anpassung war notwendig geworden, weil die Regierung das Wirtschaftswachstum ab 2026 auf zweistellige Werte anheben will, von durchschnittlich 6 Prozent in der letzten Dekade. Der Strombedarf steigt also stärker als bisher angenommen. Gleichzeitig hat eine Antikorruptionskampagne viele Kraftwerksprojekte verzögert.
Die revidierte Fassung umfasst wichtige Veränderungen. Zunächst hat die Regierung den Bedarf an Stromkapazitäten bis 2030 auf 183 bis 236 Gigawatt deutlich angehoben. Der ursprüngliche Plan ging von einer Leistung von 148 bis 151 Gigawatt bis 2030 aus.
Deutlich mehr Solar- und Windkraft
Erneuerbare Energien haben im neuen PDP8 deutlich höhere Ausbauziele erhalten, während der Zubau an fossilen Quellen gleich bleibt. Große Gewinner sind die Windkraft an Land oder in Küstennähe und die Solarenergie. Bei diesen Energieträgern ging 2021 eine starke Expansionsphase mit vielen Unregelmäßigkeiten zu Ende. Eine große Anzahl an Projekten ist fernab der Verbrauchszentren entstanden und etliche sind noch immer nicht ans Netz angeschlossen worden. In einigen Fällen verweigert der Staatsmonopolist Vietnam Electricity (EVN) die Einspeisevergütungen.
Nach den schlechten Erfahrungen wollte die Regierung den Ausbau eigentlich bremsen. Im neuen PDP8 soll Windkraft an Land und in Küstennähe aber von rund 22 Gigawatt auf bis zu 38 Gigawatt steigen. Auch Solarenergie soll stärker expandieren, von 12,8 Gigawatt im ursprünglichen Plan auf bis zu 73,4 Gigawatt in der neuen Version. Offshore-Windprojekte jedoch brauchen mehr Vorbereitung und wurden auf nach 2030 vertagt.
Wind- und Solarkraftkapazitäten werden deutlich ausgebaut
Entsprechend wird der Anteil erneuerbarer Energien zulegen, während der von fossilen Energieträgern zurückgeht. Die Regierung hatte bis 2030 zunächst 29 Prozent Anteil an erneuerbaren Energien angepeilt und 45 Prozent für Kohle und Gas. Nach den revidierten Plänen steigen die Erneuerbaren auf 45 bis 57 Prozent (inklusive Wasserkraft sogar auf 63 bis 71 Prozent), während Kohle und Gas auf 29 bis 35 Prozent zurückfallen.
Auch Batteriespeicher und Pumpwasserkraftwerke werden ausgebaut. Sie sollen als Ausgleich für die wechselhaften erneuerbaren Energien dienen. Hinzu kommen deutlich höhere Stromimporte (von 1,2 Gigawatt in 2024 auf 9,4 bis 12,1 Gigawatt in 2030), vor allem aus Laos und den dort entstehenden Wasserkraftwerken.
Vietnam steigt in Kernkraft ein
In der Neufassung des PDP8 will Vietnam nun mit zunächst zwei Kernkraftwerken in die Kernenergie einsteigen. Das ist eine deutliche Abkehr vom Originalplan. Die Regierung hatte 2016 die Vorhaben an den beiden Standorten in der Provinz Ninh Thuan gestoppt. Auf diesen Projekten will sie jetzt aufbauen und die Kraftwerke mit den damaligen japanischen und russischen Partnerunternehmen umsetzen. Trotzdem geht etwa die vietnamesische Fachzeitschrift Nang Luong von drei Jahren Vorbereitung und sechs bis acht Jahren Bauzeit aus. Somit dürften die Kraftwerke bestenfalls 2035 ans Netz gehen.
Rechtsrahmen für neue Investitionswelle weitgehend komplett
Der revidierte Plan ist sehr ambitioniert und die Umsetzung wird den Behörden auf allen Ebenen viel abverlangen. Die staatliche Verwaltung durchläuft derzeit eine grundlegende Reform. Vier Ministerien sind im 1. Quartal 2025 durch Zusammenlegungen weggefallen, 20 Prozent der Staatsbediensteten sollen ihren Job verlieren. Auch die Anzahl der Provinzen wird von 63 auf 34 sinken. Mittelfristig könnte die Reform tatsächlich Vorhaben erleichtern, aber zunächst erwarten Unternehmer längere Genehmigungsverfahren.
Auf der Habenseite gibt es einen neuen Rechtsrahmen für erneuerbare Energien, der in den letzten Monaten im Eiltempo mit einer Vielzahl von Dekreten komplettiert worden ist. Dabei geht es vor allem um direkte Abnahmeverträge (direct purchasing power agreements), die jetzt zwischen privaten Erzeugern und privaten Großabnehmern von Strom möglich sind. Auch die Regeln für Aufdachsolaranlagen sind vereinfacht worden. Wenn kein Netzanschluss erfolgt, gibt es etwa für Industrieparks keine Obergrenze mehr. Das dürfte zahlreiche Projekte für Exportfirmen anstoßen, die seit Jahren den garantierten Zugang zu grünem Strom verlangen.
Noch fehlen die Höchstpreise für die Vergütung von Batteriespeichern als Grundlage etwaiger Preisverhandlungen zwischen EVN und den privaten Abnehmern. Bei Solarparks auf Land oder auf Wasser gibt es allerdings eine höhere Vergütung, wenn Projekte mit Speichern gekoppelt werden, die mindestens 10 Prozent der Leistung der Anlagen umfassen. Unternehmer sprechen von einer Übergangsphase, in der sich die neuen Regeln erst in der Praxis beweisen müssen. Auch müssen Vorhaben oft erst vorbereitet werden. Deshalb rechnen Beobachter Anfang 2026 mit dem Beginn einer neuen Investitionswelle im Bereich erneuerbarer Energien.
Qualität gewinnt an Stellenwert
Deutsche Firmen wie Enertrag, wpd und PNE haben seit Jahren Projekte vorbereitet und stehen in den Startlöchern. Für deutsche Techniklieferanten in Vietnam hat sich die Konkurrenz aus China verschärft, sowohl bei Wechselrichtern als auch bei Windkraftanlagen. Die Hoffnung ist, dass viele Entwickler auf europäische Anbieter zurückgreifen werden, weil diese mehr Referenzprojekte vorweisen können und als verlässlicher gelten. Etliche Entwicklerfirmen hatten in der letzten Expansionsphase bis 2021 Projekte zu schnell und in schlechter Qualität umgesetzt. Sie hatten dann Probleme, diese weiterzuverkaufen und könnten daher künftig stärker auf Qualität achten.
VIETNAM / STADTENTWICKLUNG: Vietnam hat neue Ambitionen für Tourismusstadt Danang
Im zentralvietnamesischen Danang wird derzeit kräftig gebaut, vor allem Hotels und Technologieparks. Auch einige deutsche Firmen setzen auf Standorte in der Region.
Wie in anderen Städten Vietnams wurden seit 2024 auch in der Touristenmetropole Danang zahlreiche brachliegende Bauprojekte wieder aufgenommen. Dies betrifft vor allem den Hotelbau. Hier sollen sechs Projekte bis Mitte 2026 fertig gebaut werden. Die Nachfrage stimmt: 2024 kamen mit 10,4 Millionen Touristen 25 Prozent mehr in die Stadt als 2019.
Danang will 2025 bei neun weiteren Hotelvorhaben alle Hindernisse für den Weiterbau aus dem Weg räumen. Nach Informationen der Stadtverwaltung sind im 1. Quartal 2025 Projekte im Wert von rund 5 Milliarden US-Dollar (US$) wieder in Gang gekommen.
Noch stehen viele unfertige Bauten im zentralvietnamesischen Danang. Diese säumen zum Teil auch die Küstenstraße zwischen Danang und Hội An. Der explosive Hotelbauboom hatte 2019 ein Ende gefunden, als die vietnamesische Regierung im Rahmen einer Antikorruptionskampagne begann, Projekte näher unter die Lupe zu nehmen. Auch Corona-Lockdowns und die Aufdeckung von Immobilienskandalen stoppten damals die Arbeit auf vielen Baustellen.
Parks für IT und Hightech
Danang ist nicht nur auf Tourismus ausgerichtet. Das Ziel der Stadt, eine Technologiemetropole zu werden, hat sich aber nur teilweise erfüllt. Zwar ist der Software-Park 1 im Stadtzentrum voll besetzt und Entwickler wie Ubisoft aus Frankreich entwerfen hier Computerspiele. Aber es gibt auch noch einen nicht fertig gebauten IT-Park sowie einen Industriepark für Hightech, der weitgehend leer steht. Dennoch sind FPT und Viettel, die führenden Technologieunternehmen des Landes, präsent und sie investieren weiter. FPT kann sogar eine eigene Universität zur Ausbildung von IT-Kräften vorweisen.
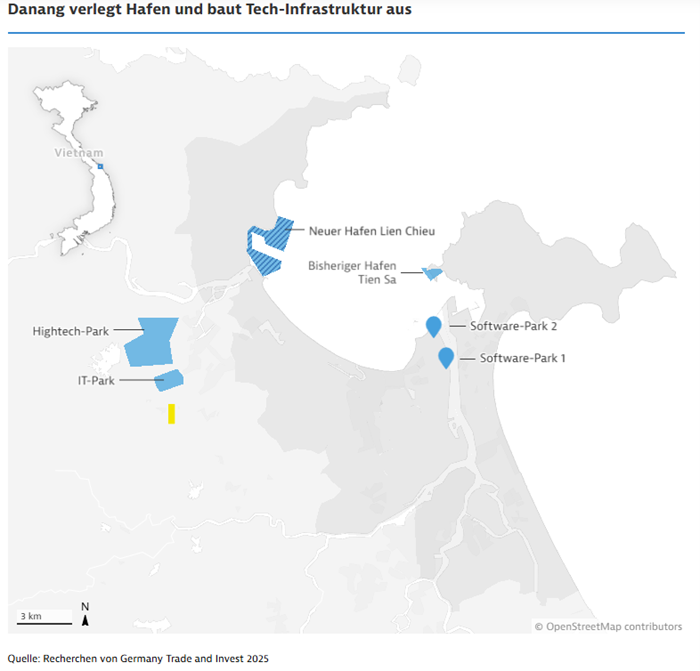
Im Jahr 2025 sollen drei Bürogebäude mit insgesamt 50.000 Quadratmetern Fläche im Software-Park 2 bezugsfertig werden. Anfang des Jahres hat die Stadt bereits das erste Gebäude eröffnet. In die Büros sollen nicht nur klassische Software-Firmen zu günstigen Mieten einziehen, sondern auch Firmen für Halbleiterdesign. Für diese wird auch ein Labor eingerichtet. Etwa 30 Firmen haben bereits Interesse bekundet, darunter Synopsys, Synapse, Marvell, Uniquify und Renesas. Für Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz wird seit April 2025 im Hightech-Park ein Datenzentrum gebaut.
Derzeit sind 14 Firmen für Halbleiterdesign in Danang präsent. Sie beschäftigen etwa 600 Ingenieure. Durch Kooperationen mit ausländischen Universitäten und die Förderung von Ausbildung sollen es bis 2030 etwa 5.000 sein, davon 2.000 im Chip-Design und 3.000 im Bereich Verpackung und Testen. Für letzteres gibt es in Danang bisher noch keine Betriebe. Die Stadt hat sich zumindest ein Ansiedlungsprojekt zum Ziel gesetzt.
Noch weniger ausgereift ist die Strategie, zu einem regionalen Finanzplatz zu werden. Die Regierung hat hierfür neben Ho-Chi-Minh-Stadt auch Danang ausgewählt.
Danang bekommt einen neuen Hafen
Auch an Infrastrukturvorhaben wird in Danang wieder gearbeitet. Als zentrales Großprojekt soll der Hafen an den Nordrand der Stadt verlegt werden. Die Docks standen Anfang 2025 weitgehend bereit. Private Betreiber sollen hier in den kommenden Jahren 22 Hafenterminals für insgesamt 2 Milliarden US$ einrichten. Ein Anschluss an die Ringautobahn ist überwiegend fertig. Der alte Hafen soll künftig dem Militär und dem Tourismus dienen. Der neue Hafen ist vor allem für kommerzielle Zwecke vorgesehen.
Hinter dem neuen Hafen ist eine Freihandelszone geplant. Derartige Zonen gibt es in Vietnam bisher nicht. Danang ist ein Pilotprojekt, das Industrieansiedlungen vereinfachen könnte.
Infrastrukturelle Probleme erschweren ausländischen Firmen den Start
Zentralvietnam birgt den Vorteil, dass die Kosten und die Mitarbeiterfluktuation im Vergleich zu beispielsweise Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi niedriger sind. Danang verfügt zwar über einen von zwei Hochtechnologie-Industrieparks in Vietnam. Während der Park östlich von Ho-Chi-Minh-Stadt weitgehend belegt ist, gibt es im Park in Danang bislang kaum Fabriken. Im Hightech-Park gibt es mehr Vergünstigungen als in anderen Parks. Deshalb sind die Kriterien in Bezug auf die Definition, was unter Hightech fällt, sehr strikt. Zudem ist es für Investoren in Danang schwer, qualifizierte Mitarbeiter zu finden.
Nach Aussagen von Austin Weyers, stellvertretender Direktor der Immobilienagentur CRV, gibt es zudem für ausländische Investoren fast ausschließlich alte Fabrikhallen von Textilfirmen zu mieten. Die alten Hallen entsprechen oftmals nicht den Ansprüchen westlicher Unternehmen.
Deutsche Fabriken siedeln sich südlich von Danang an
In den Nachbarprovinzen Quang Nam im Süden und Thua Thien Hue im Norden gibt es hingegen ausreichend Grundstücke in Industrieparks, zu deutlich geringeren Kosten als in Danang. Quang Nam wird noch 2025 im Zuge einer Verwaltungsreform mit Danang zu einer Provinz verschmolzen. Hier haben sich etliche deutsche Firmen angesiedelt und bilden das größte deutsche Cluster in Zentralvietnam.
Der deutsche Hersteller von Nadeln für Textilmaschinen Groz-Beckert hat bereits 2012 unweit von Hội An ein Werk errichtet und dieses 2019 um eine weitere Halle ergänzt. Dräxlmeier lässt im Industriepark Tam Thang 1 nördlich von Tam Ky Kabelbäume konfektionieren. In unmittelbarer Nähe unterhalten auch Amann (Garne) und Wendler (Einsteckstifte für Hemdkragen) Fabriken. Im Industriepark Tam Thang 2 extrudiert die OKE Group Profile für Sitze und Möbel. Noch im Bau ist ein Werk der Firma OBE, die Brillenscharniere herstellen wird. Nahe am Hafen Chu Lai hat Kärcher 2024 ein Werk für Reinigungsgeräte eröffnet. Unweit davon montiert der große vietnamesische Kfz-Teilehersteller Thaco vier Modelle von BMW.
Ein Manko ist allerdings die schlechte Verfügbarkeit von bezugsfertigen Fabrikhallen. Vor allem deutsche Firmen bevorzugen diese, um schnell den Betrieb aufnehmen zu können. Im Industriepark Tam Thang 2 lässt die Immobilienvermittlung CRV derzeit zwei Hallen zur Vermietung errichten.
Europa
DÄNEMARK / AGRAR: Dänemark baut Bio-Vorsprung aus
Deutsche Anbieter von Bioprodukten sollten ihren Blick nach Norden richten. Ein Markt in Skandinavien ragt besonders heraus.
Bis 2030 soll in Dänemark der Anteil von Bioprodukten am Umsatz des gesamten Lebensmittelmarkts auf knapp 20 Prozent ansteigen. Dies ergeben neu veröffentlichte Daten des Statistik-Portals Statista. Im skandinavischen Vergleich liegt Dänemark damit vorn beim Umsatz mit Biolebensmitteln: Im Jahr 2024 lag deren Anteil dort bei 15,9 Prozent, in Schweden bei 8,3 Prozent und in Norwegen sogar nur bei 3,4 Prozent. Damit festigt sich der Trend zur ökologisch-nachhaltigen Ernährung, besonders auf dem dänischen Markt.
Die dänische Regierung hat den Trend für nachhaltig produzierte Lebensmittel früh erkannt. Sie veröffentlichte im Oktober 2023 sogar den ersten nationalen Aktionsplan für rein pflanzenbasierte Ernährung. Etwa 170 Millionen Euro wurden für die Förderung der Produktion pflanzenbasierter verarbeiteter Lebensmittel bereitgestellt. Der Großteil der staatlichen Gelder floss in einen neu angelegten Fonds, „The Plant-Based Food Grant“. Für die erste Förderrunde im Jahr 2024 waren 101 Anträge von Start-ups, Universitäten und anderen Organisationen eingereicht worden, die mehr als das Dreifache des zugewiesenen Budgets von knapp 8 Millionen Euro beantragten.
Ein Beispiel für ein gefördertes Unternehmen ist Nordic Harvest. Es betreibt die größte vertikale Farm Europas und vereint die Trends Nachhaltigkeit und ökologischen Anbau. Angebaut werden Gemüse und Kräuter in Hydrokultur auf 14 Etagen. Auch ein Markteintritt in Deutschland steht für das Unternehmen im Raum.
EU / AGRAR: Mit Smart Farming wird Europas Landwirtschaft wettbewerbsfähig
Europas Landwirtschaft kämpft mit Klimawandel und internationaler Konkurrenz. Agritech soll helfen. GTAI analysiert die wichtigsten europäischen Agrarmärkte.
Die europäische Landwirtschaft steht unter Druck. Ob Löhne, Energie, Dünge- oder Futtermittel: Steigende Kosten verteuern die Produktion. Die Ansprüche an Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung steigen, zeitgleich müssen sich Landwirte an zunehmend unvorhersehbare Klimaphänomene anpassen. Immer weniger Menschen wollen in der Landwirtschaft arbeiten. Und bei alledem kämpft Europas Landwirtschaft darum, in einem immer härteren internationalen Wettbewerb zu bestehen. „Wenn wir keine Anstrengungen unternehmen, neue Technologien auszurollen, werden wir auf Dauer nicht wettbewerbsfähig bleiben. Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit kann es nur mit Innovation geben“, sagt Lucas Wadt, Leiter Kooperationen beim französischen Genossenschaftsverbund Fermes LEADER.
Smart Farming und Agritech-Lösungen gelten als Mittel der Wahl, um Landwirte auf dem Weg in die Zukunft zu unterstützen. Der Marktanalyst Research and Markets prognostiziert für den europäischen Smart-Agriculture-Markt zwischen 2024 und 2034 ein aggregiertes jährliches Wachstum von 18,7 Prozent. Von knapp 4 Milliarden Euro im Jahr 2024 soll, so den Prognosen zufolge, der Markt auf 22,2 Milliarden US$ steigen.
Vor allem Frankreich und die Niederlande stechen sowohl bei der Marktgröße als auch bei den Wachstumsraten heraus. Das Marktforschungsinstitut Grand View Research schätzt das Marktvolumen des niederländischen Smart-Agriculture-Sektors für das Jahr 2024 auf 492 Millionen US-Dollar (US$) und prognostiziert für 2025 bis 2030 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 12,9 Prozent. Für Frankreich erwartet das Institut für den gleichen Zeitraum sogar Wachstumsraten von 16,5 Prozent. 2,9 Milliarden Euro soll der französische Smart-Farming-Markt im Jahr 2030 erreichen. Aber auch in anderen Ländern Europas entwickelt sich der Sektor lebhaft. Germany Trade & Invest (GTAI) hat die wichtigsten europäischen Agrarmärkte analysiert.
Agritech soll Kosten sparen
Landwirte nutzen Werkzeuge wie Präzisionssensoren, autonome Maschinen und KI-gestützte Analysen, um Produktivität und Nachhaltigkeit zu steigern. Je nach Markt steht das eine oder andere im Vordergrund.
In den Niederlanden ist es die Nachhaltigkeit. Technologische Innovationen aus den Kategorien IoT, Drohnen sowie KI-Algorithmen treiben den niederländischen Smart Farming-Markt an.
Landwirte in Polen betrachten Smart Agriculture hingegen als Werkzeug, um die Kosten im Griff zu halten. „Preise für Energie, Düngemittel und Arbeitskräfte sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen“, betont Łukasz Rachubiński und stellt fest: „Mit Smart Agriculture lassen sich Ressourcen einsparen.“ Vor allem neue Erntemaschinen, Werkzeuge für Präzisionslandwirtschaft oder Anlagen für die Tierhaltung sind gefragt.
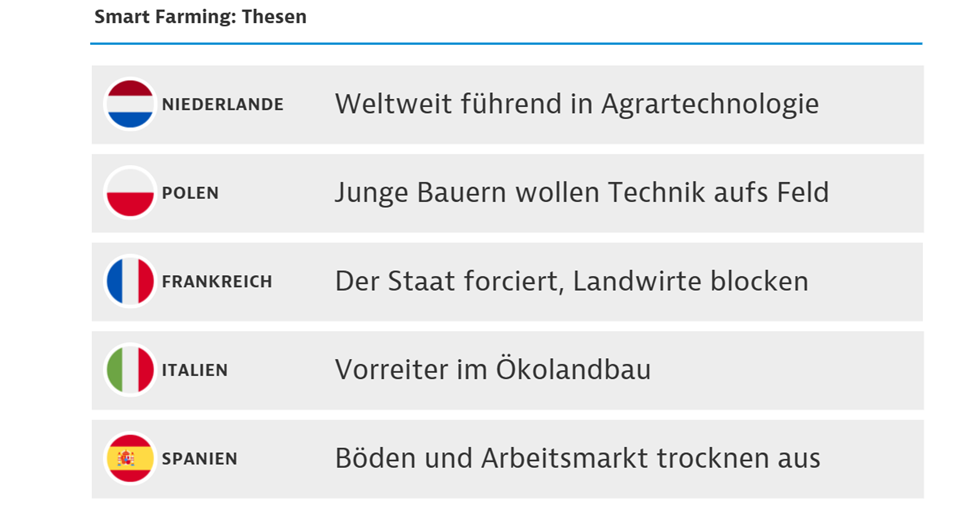
Digitale Lösungen schonen Ressourcen
Drohnen, Sensorik und eine intelligentere Bewässerungstechnik sollen in Italien, Spanien und Frankreich dabei helfen, Wasser zu sparen und Schädlinge zu bekämpfen. So setzen französische Landwirte Smart Agriculture im Kampf gegen Feldfrucht- und Tierseuchen ein oder um sich an Dürren und Überschwemmungen anzupassen. Auch die Arbeitserleichterung und Ersatz knapper menschlicher Arbeitskraft gewinnt angesichts einer alternden bäuerlichen Bevölkerung an Bedeutung.
Robotiklösungen wie autonome Unkrautjäter hingegen sind noch kaum vertreten. Bislang bleiben die verfügbaren Lösungen in der praktischen Anwendung hinter den Erwartungen zurück und rentieren sich noch nicht. Und autonome, selbstfahrende Geräte wie Traktoren oder Mähdrescher sind aus regulatorischen Gründen häufig noch nicht verkaufsfähig.
In Spanien ist es auch der Arbeitskräftemangel, der in ländlichen Regionen Digitalisierung und Technisierung treibt. Der internationale Wettbewerb drängt spanische landwirtschaftliche Betriebe dazu, immer produktiver zu wirtschaften. Betriebe möchten zu einem gewissen Grad robotisieren, vor allem bei Ernte und Schädlingsbekämpfung, aber auch in der Vieh- und Milchwirtschaft. Technologien für das Erkennen und Behandeln von Krankheiten bei Pflanzen und Tieren sind ebenfalls gefragt. In Italien wird ein Fünftel der Agrarfläche ökologisch bewirtschaftet, daher sind digitale Nachhaltigkeitslösungen von besonderer Bedeutung.
Start-ups positionieren sich
Damit es Smart Agriculture auf die Felder und in die Ställe Europas schafft, setzen Europas Regierungen auf Start-ups und Start-up-Förderung. Die französische Agritech-Szene profitiert von einer intensiven staatlichen Förderung. Im Rahmen des Innovationprogramms France 2030 stellt das Land 2,3 Milliarden Euro an Fördermitteln für den Bereich Smart Agriculture zur Verfügung. Zudem existiert mit den Initiativen French Tech, La Ferme Digitale und FrenchAgriTech sowie lokalen Initiativen wie Rising Sud ein gut ausgebautes Ökosystem.
723 Start- und Scale-ups mit einer Gesamtbewertung von 13,4 Milliarden Euro sind im Bereich Agritech aktiv, so LaFrenchTech, die französische Start-up-Dachorganisation. Allerdings hat die Agritech-Startup-Szene zuletzt etwas an Dynamik verloren. „In Frankreich läuft gerade eine Konsolidierungsphase, nur wenige Start-ups kommen neu auf den Markt“, beobachtet Lucas Wadt von Fermes LEADER.
Auch in Polen wächst die Jungunternehmer-Szene. EIT Food – ein EU-geförderter Thinktank – hat in Warschau ein neues Accelerator-Programm für landwirtschaftliche Technologien eingerichtet. Jedes Jahr können sich 10 Start-ups jeweils bis zu 50.000 Euro sichern. Auch das staatliche Forschungszentrum NCBR unterstützt die Entwicklung neuer Smart Agriculture Technologien finanziell. Die staatliche Förderanstalt für die Landwirtschaft KOWR entwickelt aktuell ein satellitengestütztes System zur Überwachung von Nutzpflanzen (S2MUR).
Internationale Partner gefragt
Die niederländische Regierung treibt die Entwicklung von Smart Farming voran. Dabei verfolgt sie eine umfassende Strategie für Innovation und Nachhaltigkeit. Darüber hinaus setzt die Regierung auf internationale Partnerschaften und Wissensaustausch, um globale Herausforderungen in der Landwirtschaft zu bewältigen. Initiativen wie das „National FieldLab Precision Agriculture“ und die „Farm of the Future“ in Lelystad unterstützen Landwirte bei der Anwendung moderner Techniken.
Italien fördert die Entwicklung eines eigenen Agritech-Sektors unter anderem durch die öffentlichen Förderprogramme Agricoltura 5.0 und Credito d’Imposta 4.0. Laut einer Studie von Politecnico Milano gab es 2024 in Italien bereits 386 Smart-Farming-Anbieter. Die Zahl der Start-ups steigt rasch und lag Anfang 2025 bei 164 Smart-Farming-Startups. Besonders künstliche Intelligenz und Machine Learning ist ein Wachstumsmotor. Hierfür gab es 2024 laut Politecnico Milano 22 Prozent mehr Start-ups.
Und auch in Spanien sind neben etablierten Unternehmen vor allem Neugründungen im Bereich Agritech aktiv. Insgesamt 146 Start-up-Unternehmen bearbeiteten laut spanischer Wirtschaftsförderungsgesellschaft ICEX im Jahr 2024 den Markt.
Akzeptanz nicht überall gleich
Agritech auf den Höfen Europas unterzubringen, ist indes nicht immer einfach. Zwar besteht grundsätzlich großes Interesse an Innovation, aber es gibt auch Vorbehalte. Nicht selten scheuen Anwender Preis und Aufwand der Einführung neuer Produkte. Dies trifft gerade auf kleinere Höfe oder ältere Nutzer zu. Und übergreifend gilt: Der Einsatz von smarter Technologie muss sich wirtschaftlich rechnen.
In Polen kommt Smart Agriculture bislang nur auf wenigen Höfen zum Einsatz. Der Einsatz teurer Smart-Farming-Technologien rentiert sich auf den im Durchschnitt gut 11 Hektar kleinen Bewirtschaftungsflächen kaum. Das Interesse an Smart-Farming-Technologien aber steigt aus einem anderen Grund, sagt Piotr Łuczak, Leiter der landwirtschaftlichen Beratungsagentur Agro Creative Agency:
„In kaum einem anderen Land der EU sind die Landwirte so jung wie in Polen. Junge Menschen begeistern sich für neue Technologien. Sie sind in der Regel die treibende Kraft hinter dem technologischen Wandel auf den Höfen ihrer Eltern und auf ihren eigenen Höfen.“
Kleinbetriebe scheuen Investitionen
Auch in Frankreich zeigen sich Landwirte gegenüber Agritech oft zurückhaltend, gerade bei Sprunginnovationen. Denn oftmals sind die Folgen des Einsatzes neuer Methodologien auf dem eigenen Grund und Boden nicht abschätzbar. Und der Bauer trägt das Risiko des Einsatzes selbst.
In Spanien stellt die Vielzahl an kleinen Familienbetrieben die Anbieter von Smart-Farming-Lösungen vor Herausforderungen. Zwei Drittel aller landwirtschaftlichen Betriebe in Spanien bewirtschaften weniger als 10 Hektar Fläche. Den Familienhöfen fehlen die finanziellen Mittel und oft noch die Bereitschaft, um in neue Technologien zu investieren, meint Máximo Bourdette, Co-Gründer des Start-ups Agrointel aus Spanien:
„Viele Landwirte sind noch in einer traditionellen Arbeitsweise verhaftet. Für neue Technologien ist viel Überzeugungsarbeit notwendig.“
Die Niederlande hingegen gelten als ausgesprochen offen für neue Technologien. Und dies gilt auch für Agrartechniken. Die Mehrzahl der landwirtschaftlichen Betriebe setzt auf intelligente Agritech-Lösungen. Immer und überall aber gilt: Erfahrung ist und bleibt das beste Verkaufsargument, weiß Lucas Wadt, Fermes LEADER Frankreich: „Wenn der Nachbarhof die Technologie nutzt und sie bei ihm funktioniert, dann nimmt der nächste Landwirt die Lösung auch.“
EU / ANTIDUMPING: Luftreifen aus Kautschuk mit Ursprung in China
Die Europäische Kommission leitet ein Antidumpingverfahren ein.
Diese Waren sind betroffen
Gegenstand der Untersuchung sind neue Luftreifen aus Kautschuk von der für Personenkraftwagen (einschließlich Kombinationskraftwagen und Rennwagen) und für Omnibusse und Kraftfahrzeuge für den Transport von Waren verwendeten Art mit einer Tragfähigkeitskennzahl von 121 oder weniger mit Ursprung China. Die Ware wird derzeit unter den folgenden KN-Codes eingereiht: 4011 10 00 und 4011 20 10.
So sieht der Zeitplan aus
Stellungnahmen interessierter Parteien sind innerhalb der in der Bekanntmachung genannten Fristen bei der Europäischen Kommission einzureichen. Die Bekanntmachung enthält ausführlichere Informationen zur Untersuchung und die Kontaktdaten der Kommission (siehe Punkt 5.8 der Bekanntmachung).
Die Kommission hat insgesamt 14 Monate Zeit, um die Untersuchung abzuschließen. Es besteht die Möglichkeit, vor Abschluss des Verfahrens vorläufige Maßnahmen einzuführen. Dies geschieht in der Regel sieben bis acht Monate nach Veröffentlichung der Einleitungsbekanntmachung, sofern die Kommission davon Gebrauch macht.
Die EU-Kommission beabsichtigt, die zollamtliche Erfassung der Einfuhren anzuordnen. Hierzu folgt eine separate Verordnung. Die Kommission hat Ende September beschlossen, bei allen laufenden Antidumping- und Antisubventionsverfahren die betroffenen Einfuhren zollamtlich zu erfassen, um ggf. Antidumpingzölle rückwirkend erheben zu können.
Das Verfahren wird auf Antrag der Coalition against Unfair Tyre Imports im Namen des Wirtschaftszweigs der Union für Reifen für Personenkraftwagen und leichte Lastkraftwagen eingeleitet.
Quelle:
Bekanntmachung der Einleitung eines Antidumpingverfahrens betreffend die Einfuhren neuer Luftreifen aus Kautschuk von der für Personenkraftwagen, Omnibusse und Kraftfahrzeuge für den Transport von Waren verwendeten Art mit einer Tragfähigkeitskennzahl von 121 oder weniger mit Ursprung in der Volksrepublik China; ABl. C vom 21. Mai 2025.
EU / ANTIDUMPING: Waren aus Gusseisen
Die EU-Kommission ordnet die zollamtliche Erfassung der betroffenen Einfuhren an. Das Antidumpingverfahren betrifft Einfuhren mit Ursprung in Indien und der Türkei.
Die EU erfasst alle Einfuhren von Waren, die Gegenstand einer Antidumping- oder Antisubventionsuntersuchung sind. Mit einer zollamtlichen Erfassung ist es möglich, Antidumpingzölle unter bestimmten Bedingungen auch rückwirkend zu erheben. Nun ordnet die EU-Kommission die zollamtliche Erfassung von bestimmten Waren aus Gusseisen mit Ursprung in Indien und der Türkei ab 21. Mai 2025 an.
Diese Waren sind betroffen
Die zollamtliche Erfassung betrifft die Einfuhren, die Gegenstand der Antidumpinguntersuchung sind. Dabei handelt es sich um bestimmte Waren aus Gusseisen mit lamellarem Grafit (Grauguss) oder Gusseisen mit Kugelgrafit (auch bekannt als duktiles Gusseisen) und Teile davon.
Es handelt sich dabei um:
- Waren der zur Abdeckung von ober- oder unterirdischen Systemen und/oder als Öffnungen für ober- oder unterirdische Systeme verwendeten Art, sowie
- Waren der zur Ermöglichung des Zugangs zu ober- oder unterirdischen Systemen und/oder der zur Ermöglichung einer Sichtprüfung von ober- oder unterirdischen Systemen verwendeten Art.
Die Waren können maschinell bearbeitet, beschichtet, überzogen und/oder mit anderen Werkstoffen gefüllt werden, beispielsweise mit Beton, Pflastersteinen oder Platten.
Die Ware wird derzeit unter den folgenden KN-Codes eingereiht: ex 7325 10 00 und ex 7325 99 10 (TARIC-Codes 7325 10 00 31 und 7325 99 10 60).
Die folgenden Warentypen sind aus der Definition der betroffenen Ware ausgenommen:
- Rinnenroste und Gussaufsätze nach EN 1433 als Bestandteil für Rinnen aus Polymer, Kunststoff, verzinktem Stahl oder Beton, durch die Oberflächenwasser in die Rinne fließen kann;
- Bodenabläufe, Dachabläufe, Reinigungsöffnungen und Abdeckungen für Reinigungsöffnungen nach EN 1253;
- Steigeisen, Hebeschlüssel und Hydranten.
- So sieht der Zeitplan aus
Die Kommission hat insgesamt 14 Monate Zeit, um die Untersuchung abzuschließen; in diesem Fall bis Ende April 2026. Es besteht die Möglichkeit, vor Abschluss des Verfahrens vorläufige Maßnahmen einzuführen. Dies geschieht in der Regel sieben bis acht Monate nach Veröffentlichung der Einleitungsbekanntmachung, sofern die Kommission davon Gebrauch macht.
Das Verfahren wird auf Antrag vom Verband Eurofonte eingeleitet.
EU / ANTIDUMPING: Weichholzsperrholz mit Ursprung in Brasilien
Die EU-Kommission ordnet die zollamtliche Erfassung der betroffenen Einfuhren an. Das Antidumpingverfahren läuft seit März 2025.
Die EU erfasst alle Einfuhren von Waren, die Gegenstand einer Antidumping- oder Antisubventionsuntersuchung sind. Mit einer zollamtlichen Erfassung ist es möglich, Antidumpingzölle unter bestimmten Bedingungen auch rückwirkend zu erheben. Nun ordnet die EU-Kommission die zollamtliche Erfassung von Weichholzsperrholz mit Ursprung in Brasilien ab 22. Mai 2025 an.
Diese Waren sind betroffen
Die zollamtliche Erfassung betrifft die Einfuhren, die Gegenstand der Antidumpinguntersuchung sind. Dabei handelt es sich um Sperrholz, ausschließlich aus Furnieren (andere als Bambus) mit einer Dicke von sechs mm oder weniger, mit beiden äußeren Lagen aus Nadelholz, auch überzogen oder auf der Oberfläche beschichtet, mit Ursprung in Brasilien.
Die Ware wird derzeit unter folgendem KN-Code eingereiht: 4412.39.00.
So sieht der Zeitplan aus
Die Kommission hat insgesamt 14 Monate Zeit, um die Untersuchung abzuschließen; in diesem Fall bis Mitte Mai 2026. Es besteht die Möglichkeit, vor Abschluss des Verfahrens vorläufige Maßnahmen einzuführen. Dies geschieht in der Regel sieben bis acht Monate nach Veröffentlichung der Einleitungsbekanntmachung, sofern die Kommission davon Gebrauch macht.
Das Verfahren wird auf Antrag von Softwood Plywood Consortium eingeleitet.
EU / ANTIDUMPING: Polyethylenterephthalat mit Ursprung in Vietnam
Die Europäische Kommission leitet ein Antidumpingverfahren ein.
Diese Waren sind betroffen
Gegenstand der Untersuchung ist Polyethylenterephthalat (PET) mit einer Viskositätszahl von 78 ml/g oder mehr gemäß ISO-Norm 1628-5, mit Ursprung in Vietnam. Die Ware wird derzeit unter folgendem KN-Code eingereiht: 3907 61 00.
So sieht der Zeitplan aus
Stellungnahmen interessierter Parteien sind innerhalb der in der Bekanntmachung genannten Fristen bei der Europäischen Kommission einzureichen. Die Bekanntmachung enthält ausführlichere Informationen zur Untersuchung und die Kontaktdaten der Kommission (siehe Punkt 5.8 der Bekanntmachung).
Die Kommission hat insgesamt 14 Monate Zeit, um die Untersuchung abzuschließen. Es besteht die Möglichkeit, vor Abschluss des Verfahrens vorläufige Maßnahmen einzuführen. Dies geschieht in der Regel sieben bis acht Monate nach Veröffentlichung der Einleitungsbekanntmachung, sofern die Kommission davon Gebrauch macht.
Die EU-Kommission beabsichtigt, die zollamtliche Erfassung der Einfuhren anzuordnen. Hierzu folgt eine separate Verordnung. Die Kommission hat Ende September 2024 beschlossen, bei allen laufenden Antidumping- und Antisubventionsverfahren die betroffenen Einfuhren zollamtlich zu erfassen, um ggf. Antidumpingzölle rückwirkend erheben zu können.
Das Verfahren wird auf Antrag von PET Europe eingeleitet.
EU / MIKROELEKTRONIK: Europas Halbleiterindustrie im Rennen um den Weltmarkt
Zukunftstechnologien brauchen eine starke Chipindustrie. Deshalb hat die EU ein riesiges Investitionsprogramm gestartet. Von den Projekten profitieren auch deutsche Unternehmen.
Halbleiter sind ein Grundbaustein der digitalen Welt. Kaum ein industrielles Erzeugnis kommt heute noch ohne sie aus. Und der Hunger nach Mikrochips wächst. Ob Energiewende, Elektromobilität, das Internet der Dinge oder künstliche Intelligenz – moderne Technologien verlangen nach immer mehr Rechenleistung und effizienten Speicherlösungen.
Will die EU globale Technologietrends auch in Zukunft mitgestalten, braucht sie eine leistungsfähige Mikroelektronikbranche. Der EU Chips Act soll Europas Halbleiterproduktion zurück zu einem Spitzenplatz verhelfen und ihre technologische Souveränität bewahren. Dafür sind hohe Investitionen und bessere Rahmenbedingungen nötig.
Germany Trade & Invest (GTAI) hat europaweit angekündigte Investitionsvorhaben der Halbleiterindustrie recherchiert, mit Fachleuten gesprochen und das Stärken-Schwächen-Profil der Branche analysiert. Unser Fazit: Die EU verfügt bereits über starke Ökosysteme für die Halbleiterindustrie. Bei vielen Ausrüstungen für die Produktion von Mikroelektronik ist der Kontinent sogar weltweit führend.
Doch neben den massiven Subventionen für große Chipfabriken muss Europa mehr tun für die Ausbildung von Fachkräften, für eine marktnahe Forschungslandschaft und für eine stärkere Nachfrage nach hochmodernen Halbleitern. Außerdem müssen die Standortbedingungen verbessert werden. Dazu gehören schnellere Genehmigungsverfahren, günstigere Energiekosten und eine technische Infrastruktur auf Spitzenniveau. Wenn das gelingt, hat die EU eine gute Chance, im Wettrennen der Halbleiterindustrie nicht den Anschluss zu verlieren.
Zu den Entwicklungen und Projekten in Europa: Europas Halbleiterindustrie
ITALIEN / CHEMIE: Italiens Chemieindustrie investiert in Nachhaltigkeit
Italiens Chemieindustrie ist forschungsstark. Große Bedeutung haben in den kommenden Jahren die Digitalisierung und der klimagerechte Umbau der Produktion.
Ausblick der chemischen Industrie in Italien
- Die italienische Chemieproduktion soll 2025 um 1,5 Prozent steigen.
- Die Hersteller investieren, auch um den Ressourceneinsatz zu optimieren.
- Höhere Zölle auf dem wichtigen US-Markt können jedoch den Export beeinträchtigen.
Zu den Markttrends, Branchenstruktur, Nachhaltigkeit und Rahmenbedingungen im Einzelnen: Chemische Industrie Italien
ITALIEN / VERSICHERUNGSRECHT: Italien führt Pflichtversicherung gegen Naturkatastrophen ein
So reagiert Italien auf die zunehmende Gefährdung durch extreme Naturereignisse wie Erdbeben und Überschwemmungen, die auch in der Wirtschaft erhebliche Schäden anrichten.
Das italienische Haushaltsgesetz für 2024 (Legge 30 dicembre 2023, Nr. 213) sieht in Art. 1 Ziffer 101 unter anderem eine Pflichtversicherung für alle im italienischen Handelsregister eingetragenen Unternehmen vor. Zweck ist der Schutz der Produktionsmittel bei gleichzeitiger Entlastung der Staatsfinanzen.
Das Gesetz und das Ministerialdekret 18/2025 legen fest, welche Vermögenswerte gegen Katastrophenrisiken versichert werden müssen, und beziehen sich dabei auf die in Art. 2424 des Bürgerlichen Gesetzbuches (Codice civile) genannten Güter. Dazu gehören zum Beispiel Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Maschinen, Industrie- und Gewerbegeräte, aber auch Elektro- und Heizungsanlagen.
Diese Verpflichtung, die ursprünglich für den 31. März letzten Jahres geplant war, wurde durch das Gesetzesdekret Nr. 39 vom 28. März 2025 – nach Größe der Unternehmen gestaffelt – verschoben. Insbesondere mittelständische Unternehmen haben bis zum 1. Oktober 2025 Zeit, während kleine und kleinste Unternehmen bis zum 1. Januar 2026 Zeit haben. Für große Unternehmen blieb die Verpflichtung am 1. April 2025 unverändert, aber es wird 90 Tage lang keine Strafen geben, wodurch eine Pufferzeit für die Organisierung geschaffen wird.
Bei Zuwiderhandlung drohen empfindliche Geldstrafen von bis zu 500.000 Euro und der Ausschluss von öffentlichen Aufträgen.
SCHWEDEN / WIRTSCHAFT: Schweden entwickelt nationalen Aktionsplan für E-Fuels
Schweden setzt auf die Umstellung auf fossilfreie Kraftstoffe in Luft- und Schifffahrt. Deutsche Unternehmen können zukünftig als Technologiepartner und Investoren profitieren.
Die Absage der Ørsted-Investition in Nordschweden 2024 war ein Dämpfer für die Branche – nun setzt die schwedische Regierung mit ihrem erneuten Bekenntnis zu E-Fuels ein klares Zeichen für den Weg zur Klimaneutralität bis 2045. Trafikanalys, das Amt für Verkehrsanalyse, erhielt im Mai 2025 den Auftrag, einen nationalen Aktionsplan für nachhaltige Kraftstoffe zu entwickeln. Ziel ist es, den Zugang zu fossilfreien, kohlenstoffarmen Kraftstoffen in Luft- und Schifffahrt durch mehr Inlandsproduktion und gezielte Importe zu verbessern. Bis April 2026 soll ein konkreter Maßnahmenplan vorliegen.
Die Bedingungen für die Herstellung von E-Fuels in Schweden sind denkbar gut: viel erneuerbare Energie, biogene CO₂-Quellen und ein stabiles Stromnetz. Geplant sind Investitionen in Infrastruktur, Marktanreize wie CfD-Verträge (Differenzkontrakte) und eine nationale Importstrategie. Chancen für deutsche Unternehmen bestehen im Technologieexport – etwa bei Elektrolyse, CCU-Lösungen (Abscheidung, Transport und Nutzung von Kohlenstoff) oder der Systemintegration. EU-Fördermittel wie aus dem Innovationsfonds bieten zusätzliche Hebel. Auch interessant: Die potenzielle Produktionskapazität könnte den Inlandsbedarf deutlich übersteigen – mit einem Exportpotenzial von bis zu 70 Terawattstunden.
Unter Beteiligung der deutschen Uniper wurde von fünf Unternehmen ergänzend zum Aktionsplan ein Bericht zu möglichen Steuerungselementen für die Produktion fossilfreier Elektrotreibstoffe veröffentlicht.
SPANIEN / HALBLEITER: Chipindustrie sucht ihre Rolle in Europa
Forschung und Chipdesign sind die bisherigen Stärken Spaniens, wenn es um Halbleiter geht. Mehrere neue Projekte stehen in den Startlöchern.
Anfang April 2025 hat die katalanische Regionalregierung die finanziellen Mittel für das geplante Entwicklungszentrum „InnoFab“ in der Nähe von Barcelona freigegeben. InnoFab soll an alternativen Materialien für integrierte Schaltkreise, wie zum Beispiel Graphen, forschen. Beteiligt sind das Barcelona Microelectronics Institute, das Institute of Photonic Sciences of Barcelona und die Autonomous University of Barcelona. Das Zentrum soll nach Fertigstellung Ende 2026 etwa 200 Forschenden Platz bieten. Im ersten Schritt steht nun im Jahr 2025 eine Ausschreibung für die bautechnische Projektleitung an. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 400 Millionen Euro.
Halbleiterstandort Spanien wird internationaler
Auch mehrere ausländische Unternehmen haben zuletzt Investitionen in Forschungs- und Designzentren in der spanischen Halbleiterbranche angekündigt. So plant Intel für 400 Millionen Euro ein gemeinsames Mikrochip-Entwicklungslabor mit dem Barcelona Supercomputing Center. Qualcomm baut in Madrid ein Forschungszentrum für das Anwendungsgebiet Virtual Reality auf.
Das belgische Forschungszentrum IMEC wiederum plant für 615 Millionen Euro eine Pilotlinie in Málaga (Andalusien). Im Fokus steht die Produktion von Chips der Zukunft, basierend auf neuen Materialien. Regionale Behörden haben im Januar 2025 die Baugenehmigung für die Pilotlinie erteilt.
Ebenfalls im Januar 2025 startete die Produktion von Wafern aus synthetischen Rohdiamanten des US-Unternehmens Diamond Foundry in Trujillo (Extremadura). Wafer sind die Basis zur Herstellung von Mikrochips und anderer Bauteile in der Mikroelektronik. Für das Werk hatte die EU-Kommission einen Monat zuvor Regionalfördermittel in Höhe von 81 Millionen Euro bewilligt. Diamond Foundry will den Vollausbau Ende 2025 beenden und insgesamt 675 Millionen Euro am Standort investieren.
Unternehmen kooperieren verstärkt mit europäischen Partnern
Insgesamt etwa 20 Unternehmen sind in Spanien im Bereich Chipdesign aktiv. Ein Beispiel dafür ist das spanische Start-up Openchip Software Technologies, das neben weiteren spanischen Partnerfirmen auch am neuen IPCEI-Vorhaben „Mikroelektronik“ (Important Project of Common European Interest) beteiligt ist. Für das 2021 in Barcelona gegründete Unternehmen arbeiten aktuell 150 Beschäftigte. Ende 2025 sollen es bereits 250 sein.
Ein Entwicklungsschwerpunkt sind auch photonische Halbleiter, die deutlich weniger Energie verbrauchen. So arbeiten im Rahmen der Initiative PIXEurope fünf spanische Forschungsinstitute und Universitäten mit ihren europäischen Partnern an diesem Thema. Für den Aufbau einer Pilotlinie für photonische Chips hat das Konsortium in Spanien den Standort Valencia ausgewählt. Die Projektkosten belaufen sich auf 40 Millionen Euro. Die EU-Kommission hat im Dezember 2024 grünes Licht für die Förderung von PIXEurope gegeben.
Regierung fördert die Halbleiterindustrie finanziell
Die bisher angekündigten Investitionen in Forschung und Entwicklung, Pilotlinien und Ausbildungsmaßnahmen im Halbleiterbereich summieren sich auf mehrere Milliarden Euro. Damit legt Spanien den Grundstein, um in der europäischen Halbleiterlandschaft eine noch wichtigere Rolle zu spielen. Teile der Finanzierung stammen aus Spaniens Aufbau- und Resilienzplan, den die EU 2021 genehmigt hat. Dieser teilt sich in sogenannte strategische Projekte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica – PERTE) auf.
Das an Fördermitteln größte Projekt ist das PERTE „Chip“, mit einem Volumen von 12,3 Milliarden Euro bis 2027, darunter 2,5 Milliarden Euro für Projekte im Bereich Forschung und Entwicklung sowie Chipdesign. Im Januar 2025 schloss eine weitere Ausschreibungsrunde des PERTE „Chip“ mit der Auswahl von sieben Projekten und einem Gesamtzuschuss von 40,6 Millionen Euro.
Werben für ein großes Chipwerk
Die restlichen knapp 10 Milliarden Euro des PERTE „Chip“ sind für den Aufbau einer großvolumigen Chipproduktion reserviert. Spanien ist in der Vergangenheit ein Standort für die Chipproduktion gewesen und möchte gerne wieder einer werden. Nach dem Ende der Fertigung von AT&T/Lucent Technologies am Standort Tres Cantos (Region Madrid) vor über 20 Jahren wirbt die Politik bei Chipherstellern weltweit für neue Großinvestitionen im Land. Trotz des großzügigen Angebots an Fördermitteln, gut ausgebildeter Fachkräfte und vergleichsweise niedrigen Stromkosten hat sich dieser Erfolg bisher noch nicht eingestellt.
SPANIEN / VERTEIDIGUNGSWIRTSCHAFT: Spanien investiert kräftig in die Verteidigung
Spanien will das Zwei-Prozent-Ziel der NATO erreichen: Dafür gibt Madrid zusätzlich 10,5 Milliarden Euro aus.
Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat am 23. April 2025 verkündet, im laufenden Jahr zusätzliche 10,5 Milliarden Euro für die Verteidigungsindustrie bereitzustellen. Damit erreicht Spanien das Ziel, 2 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung auszugeben. Das Gesamtbudget für die Verteidigung steigt damit auf 33,1 Milliarden Euro – ein Zuwachs von 46 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Im Jahr 2024 lag der Anteil der Verteidigungsausgaben am BIP noch bei 1,4 Prozent. Damit gehörte Spanien zu den Schlusslichtern innerhalb der NATO. Ursprünglich hatte die Regierung geplant, die Ausgaben sukzessive zu steigern und das Ziel 2-Prozent-Ziel der NATO erst 2029 zu erreichen. Aufgrund der geopolitischen Situation und durch ähnliche Pläne von Partnerländern in der EU und der NATO ist nun die Kehrtwende erfolgt.
Spanische Unternehmen als Auftragnehmer im Fokus
Die spanische Regierung verbindet diesen finanziellen Kraftakt klar mit der Vorstellung, die nationale Verteidigungsindustrie zu stärken. Rund 6 Milliarden Euro des zusätzlichen Budgets sollen über Beschaffungsaufträge der lokalen Industrie zugutekommen. Explizit nennt der Plan auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Start-ups, die bei den Auftragsvergaben berücksichtigt werden sollen. Insgesamt erwartet die Regierung durch die zusätzlichen Ausgaben die Schaffung von 36.000 neuen Stellen und 60.000 indirekten Arbeitsplätzen.
Die Regierung hat in ihrem „Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa“ genau festgelegt, wofür die zusätzlichen 10,5 Milliarden Euro ausgegeben werden sollen:
- Arbeitsbedingungen, Einsatzbereitschaft und Ausrüstung der Armee: 3,7 Milliarden Euro
- Moderne Kommunikationstechnologien und Cybersicherheit: 3,3 Milliarden Euro
- Verteidigungs- und Abschreckungstechnologien: 2 Milliarden Euro
- Unterstützung bei der Bewältigung von Notfällen und Naturkatastrophen: 1,8 Milliarden Euro
- Auslandseinsätze der Armee: 0,3 Milliarden Euro
- Rückflüsse und Anpassungen früherer Modernisierungsprogramme: -0,5 Milliarden Euro
Auch Leistungen ausländischer Unternehmen gefragt
Die anstehenden Beschaffungsaufträge brauchen größere Produktionskapazitäten im Land. Potenzielle Auftragnehmer müssen in den Aus- und Neubau von Fabriken investieren. Auch die Umstellung von ziviler Produktion auf Rüstungsproduktion kommt in Betracht. So eruieren beispielsweise Unternehmen aus der Kfz-Zulieferindustrie, Geschäftsmöglichkeiten im Bereich Verteidigung.
Ausländische Unternehmen kommen somit nicht nur als Zulieferer von Teilen bei konkreten Beschaffungsaufträgen an spanische Unternehmen in Frage. Sie können geplante Fabriken auch mit Maschinen und Ausrüstung bestücken.
Die spanische Verteidigungsindustrie wächst spätestens seit dem Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine deutlich: Das Land rangiert von 2020 bis 2024 mit einem Anteil von 3 Prozent auf Platz 9 der weltweit wichtigsten Rüstungsexportländer, berichtet das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Von 2015 bis 2019 hatte dieser Anteil noch 2,3 Prozent betragen.
Indra übernimmt die Führung der lokalen Militärindustrie
Klar zu erkennen ist die Strategie der Regierung, das börsengelistete Unternehmen Indra zu einem nationalen Champion der Verteidigungsindustrie auszubauen. Ein guter Teil des zusätzlichen Budgets dürfte dem Unternehmen über Aufträge zufließen. Der Staat hält über die nationale Beteiligungsgesellschaft SEPI (Sociedad de Participaciones Industriales) einen Anteil von 28 Prozent am Kapital von Indra.
Im Februar 2025 hat Indra bekannt gegeben, eine Mehrheit am spanischen Satellitenbetreiber Hispasat von Redeia zu übernehmen. An Hispasat ist auch die SEPI mit 10,3 Prozent beteiligt. Mit der Akquisition will Indra seine Stärken in der Weltraumkommunikation ausbauen. Es führt diese Aktivitäten im neuen Geschäftsbereich Indra Space zusammen. Im November 2024 hatte Indra bereits das spanische Unternehmen Deimos Space übernommen. Ende April 2025 hat Indra bestätigt, dass es die Übernahme des spanischen Rüstungsunternehmens EM&E (Escribano Mechanical & Engineering) prüft.
Mit einem Umsatz von 4,8 Milliarden Euro im Jahr 2024 gehört Indra noch zu den kleineren Playern in der europäischen Verteidigungsbranche. Sein Angebot in den Bereichen Cybersicherheit, Telekommunikation und militärische Systeme dürfte aber dazu führen, dass Indra in den anstehenden nationalen und europäischen Projekten eine größere Rolle spielt.
Herausforderungen bei der Finanzierung bleiben
Kritische Stimmen bemängeln, dass die nun beschlossene Ausgabensteigerung Spaniens im Bereich der Verteidigung nicht ausreiche. Die laut Plan vorgesehenen 2 Milliarden Euro für die Anschaffung von Verteidigungs- und Abschreckungstechnologien (zum Beispiel für Waffensysteme, gepanzerte Fahrzeuge, Flugzeuge) sind nur ein Fünftel der bereitgestellten 10,5 Milliarden Euro. Außerdem würde Spanien trotz der zusätzlichen Mittel dennoch nicht mit den geplanten Budgetzuwächsen der europäischen Partner Schritt halten.
Die linksgerichtete Minderheitsregierung unter Pedro Sánchez muss Rücksicht auf kleinere Regionalparteien nehmen, die erhöhten Militärausgaben eher kritisch gegenüberstehen. Gleichzeitig möchte sie ihren Bündnispartnern beim Thema Verteidigungsausgaben entgegenkommen. Bei der konservativen Opposition stößt auf Ablehnung, dass sich die Regierung die zusätzlichen Mittel nicht im Parlament absegnen lässt, sondern direkt aus verschiedenen Quellen finanziert.
Die Minderheitsregierung konnte für 2024 und 2025 noch keinen Haushalt durch das Parlament bringen. Deshalb wird das Budget des Jahres 2023 automatisch weiter fortgeschrieben. Im Ergebnis besitzt die Regierung weniger Handlungsspielraum bei neuen Themenfeldern, Reformen oder Investitionsvorhaben.
Osteuropa und Zentralasien
ASERBAIDSCHAN / AGRARSEKTOR: Geschäftschancen durch neue Agrarförderungen
Aserbaidschans Regierung treibt die Land- und Ernährungswirtschaft voran. Ziel ist eine stärkere Eigenversorgung mit Nahrungsmitteln und der Ausbau der Exporte.
Neue Förderpakete für die Landwirtschaft und den Ausbau von Agrarparks sollen die Ernährungswirtschaft in Aserbaidschan ankurbeln. Für 2025 sind im Staatshaushalt 708 Millionen US-Dollar (US$) an Subventionen vorgesehen, in den Folgejahren bis 2028 jährlich rund 710 Millionen US$. Die Mittel fließen vor allem in:
- zinsgünstige Kredite,
- Leasing-Kofinanzierungen für Landtechnik und Bewässerungssysteme,
- Subventionen für Anbauflächen und Tierzucht,
- den Aufbau von Tierzuchtbetrieben und Seidenraupenzucht,
- die Ausweitung der Agrarversicherung sowie
- die Förderung des privaten Veterinärwesens.
Im Jahr 2024 erhielten über das elektronische Agrarinformationssystem (EKTIS) jeweils mehr als 380.700 Landwirte Subventionen in Höhe von rund 200 Millionen US$ für Pflanzen- und Tierzucht – ähnlich wie im Vorjahr. Zusätzlich unterstützte der Fonds für die Entwicklung des Unternehmertums die Agrarwirtschaft mit zinsgünstigen Krediten: Von insgesamt 146 Millionen US$ entfielen 77 Millionen US$ (53 Prozent) auf die landwirtschaftliche Produktion. Weitere Mittel flossen in Projekte zur industriellen Verarbeitung agrarischer Erzeugnisse.
Neue Fördersparte: Intensiver Obstanbau
Seit 2024 ist die Palette der subventionsfähigen Bereiche in der Pflanzenproduktion deutlich erweitert. Neu gefördert werden unter anderem der Anbau von Zitrus-, subtropischen und Futterpflanzen sowie die Anlage von Intensivobstgärten für Baum- und Schalenobst. Besonders im Fokus: die Errichtung von Aprikosen- und Pfirsichplantagen in den Regionen Zentral-Aran, Mil-Mugan, Schirwan-Salyan und Karabach. Hier werden einmalige Subventionen von 4.000 Aserbaidschan-Manat (rund 2.353 US$) pro Hektar gewährt.
Ausbau von Agrarparks zielt auf mehr Effizienz in der Landwirtschaft
Der Ausbau der seit 2016 bestehenden Agrarparks soll unter neuem Management beschleunigt werden. Ziele des Programms sind die Nutzung brachliegender Flächen, der Aufbau von Wertschöpfungsketten, die Stärkung der Versorgung mit heimischen Lebensmitteln sowie die Entwicklung ländlicher Räume.
Zudem sollen die Agrarparks zur Verringerung des Außenhandelsdefizits im Agrarsektor beitragen: Zwischen 2022 und 2024 lag der jährliche Importüberschuss laut Zollstatistik bei durchschnittlich 1,5 Milliarden US$ – gegenüber 1 Milliarde US$ in den drei Jahren zuvor.
Aktuell gibt es 24 Parks, darunter 22 private, mit einer Gesamtfläche von 66.300 Hektar. Sie beschäftigen dauerhaft etwa 3.700 und saisonal rund 5.000 Arbeitskräfte. Die Parks engagieren sich zumeist in der Pflanzenproduktion, sechs in der Tierzucht.
Deren Produktionsvolumen ist überschaubar und in den letzten Jahren bei einigen Erzeugnissen geschrumpft. Die Parks produzierten im Jahr 2024 unter anderem 49.700 Tonnen Zuckerrüben, 34.100 Tonnen Weizen, 5.500 Tonnen Gerste, 92.000 Tonnen Silogetreide- und -mais, 13.700 Tonnen Kartoffeln und 3.500 Tonnen Gemüse. Die auf Tierzucht spezialisierten Agrarparks erzeugten 31.400 Tonnen Milch und 1.300 Tonnen Fleisch.
Ausbau der Agrarparks kam bisher schleppend voran
Ursprünglich sollten innerhalb weniger Jahre etwa 50 leistungsfähige Agrarparks für die Bewirtschaftung von 240.000 Hektar Agrarflächen gegründet werden. Die Ursachen für die unbefriedigende Entwicklung der Parks sind vielschichtig. Sie reichen vom mangelnden Management und einer unzureichenden Qualifizierung der Beschäftigten bis hin zu den negativen Folgen des Klimawandels für die Agrarproduktion.
Neue institutionelle Zuständigkeit für Agrarparks
Im April 2025 hat die Regierung beschlossen, die Kompetenzen für die Organisation und weitere Entwicklung der Agrarparks vom Wirtschaftsministerium (Agentur für die Entwicklung von Wirtschaftszonen) in das Ministerium für Landwirtschaft zu verlagern. Die institutionelle Neuordnung soll für mehr Effizienz und einen schnelleren Ausbau der Parks sorgen.
Neue Pilotprojekte für Agrarindustrie-Cluster gestartet
Im Landkreis Jewlach (Yevlax) entsteht ein innovativer Agrarpark. Dieser vereint kleine und mittlere Betriebe sowie verarbeitende Unternehmen in einem Cluster. Der Fokus liegt auf Getreide, Obst, Gemüse, Futtermitteln, Zuckerrüben und Saatgut. Rund 40 Wirtschaftseinheiten haben bereits Investitionen von etwa 60 Millionen US$ getätigt oder geplant. Ein weiteres Pilotprojekt läuft im Landkreis Sabirabad. Zudem wurde Ende 2024 das erste KMU-Cluster für Fruchtkonzentrate (Frutena) gegründet.
Agrarproduktion in Aserbaidschan noch wenig effizient
Der Agrarsektor beschäftigt rund 36 Prozent der Erwerbstätigen, trägt jedoch nur 5,7 Prozent zur nationalen Wertschöpfung bei (2024) – ein Hinweis auf geringe Effizienz. Ursachen sind die zersplitterte Betriebsstruktur nach der Auflösung sowjetischer Großbetriebe, der langsame Aufbau größerer Produktionseinheiten sowie geringe Investitionen von durchschnittlich nur 300 Millionen US$ jährlich (2020–2024).
Fachleute kritisieren zudem die geringe Wirkung öffentlicher Fördermittel, bedingt durch intransparente Vergabe, strikte Auflagen für Technik- und Saatgutauswahl sowie unzureichende Kontrolle. Reformen im Steuerrecht sollen künftig für mehr Transparenz und zielgerichtete Förderung sorgen.
BULGARIEN / BESCHAFFUNG: Bulgariens Bedeutung als Sourcing-Markt wächst
Die Elektroindustrie und die Kfz-Industrie beschaffen zunehmend Metallprodukte aus Bulgarien. Ganz oben auf der Einkaufsliste stehen Produkte aus Aluminium und Kupfer.
Seit dem Beitritt Bulgariens zur EU im Jahr 2007 integriert sich das Land zunehmend in internationale Wertschöpfungsketten. Beim Handel mit Deutschland erzielt Bulgarien einen Handelsüberschuss. Das südosteuropäische Land belegt in der aktuellen Rangfolge der 238 Einfuhrländer Deutschlands Platz 36. Damit rangiert Bulgarien als Beschaffungsmarkt für die deutsche Industrie knapp hinter Lieferländern wie Kanada und Slowenien.
Besonders eng verflochten mit der deutschen Wirtschaft sind die bulgarische Elektro- und Automobilindustrie. Sie liefern Kfz-Teile und andere Vorprodukte an deutsche und europäische Abnehmer. Zu den wichtigsten Exportprodukten Bulgariens zählen Vorprodukte aus Metall für den Maschinenbau. Deutsche Unternehmen greifen zunehmend auf bulgarische Auftragsfertiger zurück, um lohnintensive Produkte günstiger herzustellen und Lieferketten für Komponenten wie Schrauben zu diversifizieren. In Bulgarien sind einzelne Produktionskosten, wie Strom und Löhne, niedriger als in Deutschland.
Die Metallindustrie des Landes liefert rund ein Vierteil ihrer gesamten Fertigung nach Deutschland. Im regionalen Vergleich mit Konkurrenzmärkten wie Rumänien und Serbien zeigen sich zudem strukturelle Unterschiede. So ist Bulgariens Metallindustrie geprägt durch große Unternehmen, während es in Serbien und Rumänien im Vergleich mehr kleine und mittelständische Unternehmen gibt.
Bulgarien liefert Münzen und Batteriekästen
Bulgarien ist für die deutsche Industrie ein wichtiger Lieferant von Vorprodukten aus Kupfer, etwa für Leitungen und Umspannwerke. Der größte Hersteller von Kupferprodukten vor Ort ist Aurubis. Das Hamburger Unternehmen ist zugleich der größte deutsche Investor in Bulgarien. Es produziert in Pirdop Kupferkathoden. Sie bilden den Ausgangsstoff für elektrische Leitungen oder für Kupferlegierungen.
Darüber hinaus liefern bulgarische Unternehmen Rohlinge für Münzen. Die Europäische Zentralbank beschafft diese für ihre Euro-Cent-Münzen aus Bulgarien, berichtet der Branchenverband Bulgarian Association of the Metallurgical Industry (BAMI). Größter Kunde sind die USA. Mit einem Handelsvolumen von 208 Millionen US-Dollar war Bulgarien 2023 der drittgrößte Sourcing-Partner der Vereinigten Staaten für Münzen (Warenverzeichnis SITC 961), hinter Australien und Österreich. Dies zeigen internationale Handelsdaten der Vereinten Nationen. Zu den wichtigsten Zulieferunternehmen, die Rohlinge für die Zentralbanken anbieten, gehört das Unternehmen Sofia Med, eine Tochterfirma des belgischen Montanunternehmens Viohalco.
Im Zuge der Transformation der Energiewirtschaft wird der Bedarf an Kupferprodukten weiter wachsen, etwa für Ladestationen für Elektroautos, für Stromleitungen und andere Kabel. Damit steigt die Bedeutung bulgarischer Kupferproduzenten als Lieferanten für den europäischen Binnenmarkt. Denn die EU will die Importabhängigkeit von Kupfer aus Drittländern reduzieren. So steht Kupfer seit 2023 auf die Liste der kritischen Rohstoffe. Die EU will damit unter anderem die Produktion kritischer Rohstoffe regional fördern und deren Import aus einem Drittland pro Jahr auf maximal 65 Prozent begrenzen. „Die EU-Politik befördert die Nachfrage nach bulgarischen Metallprodukten“, bestätigt Nikolov Rangelov vom Verband BAMI.
Neben der Kupferverarbeitung bauen bulgarische Unternehmen Kästen für Autobatterien oder Karosserieteile aus Aluminium. Dafür gewinnen sie das Aluminium aus Bauxit. Auch in diesem Segment bestimmen die Energiewende und der Einsatz von Batterien eine stärkere Nachfrage. Im Jahr 2024 investierte das chinesische Unternehmen Shanghai Unison Aluminium und errichtete ein Werk für Batteriekomponenten und andere Kfz-Teilen aus Aluminium in Plowdiw. Dies bedeutet, dass sich der Wettbewerb um Kunden und Aufträge zwischen europäischen und asiatischen Herstellern weiter verschärft.
Mitgliedschaft im Schengenraum senkt Transportkosten
Die volle Integration Bulgariens in den Schengenraum seit Anfang 2025 verbessert die Bedingungen für Lieferungen ins Ausland. Sie verkürzt Wartezeiten der Lkw an den Binnengrenzen erheblich. Die bulgarische Transportbranche spart durch offene Binnengrenzen bis zu 870 Millionen Euro an Kosten für den Transport von Personen und Waren, rechnet der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss vor. Chancen bietet auch der aktuelle Ausbau der Infrastruktur, den die EU mit Förderprogrammen unterstützt. Geplant ist zum Beispiel, die Verkehrswege und Stromtrassen in Richtung Rumänien auszubauen.
Metallteile aus Bulgarien bleiben wettbewerbsfähig
Seit Jahresbeginn sinkt die Nachfrage nach Metallprodukten aus Bulgarien. Der Verband BAMI rechnet damit, dass die Metallexporte 2025 stagnieren werden. Ein Grund ist die schwache Konjunktur des größten Exportpartners Deutschland. Die Zölle der US-Regierung trüben die Absatzaussicht der Branche zusätzlich ein. Einkäufer aus Deutschland wiederum haben dadurch eine gute Verhandlungsposition gegenüber bulgarischen Lieferanten.
Auch die steigenden Energiekosten belasten die produzierenden Unternehmen in Bulgarien. Denn seit Beginn des Jahres 2025 fallen Subventionen für Unternehmen mit energieintensiver Produktion weg. Wettbewerbsfähige Löhne und Steuern kompensieren dies jedoch. Zudem sind die Energiekosten im regionalen Vergleich immer noch niedrig. Auch dies spricht für weiterhin wettbewerbsfähige Preise bulgarischer Metallprodukte.
Das Metallverarbeitende Gewerbe in Bulgarien beschäftigte 2023 rund 495.000 Personen und trägt rund 6,9 Prozent zur Bruttowertschöpfung Bulgariens bei. Zu den stärksten Segmenten der Branche zählen Kupferprodukte, Aluminiumprodukte, der Stahl- und Leichtbau sowie die Waffenproduktion. Letztere generierte seit dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine mehr Aufträge, weil Bulgarien Munition für Waffen aus dem postsowjetischen Raum produzieren kann.
KASACHSTAN / LANDWIRTSCHAFT: Kasachstan will Agrarproduktion verdoppeln
Kasachstan stehen riesige Flächen für Pflanzenbau und Tierzucht zur Verfügung. Die Regierung stellt Mittel bereit, um die Produktion zu erhöhen und Wertschöpfungsketten aufzubauen.
Ausblick der Landwirtschaft in Kasachstan
- Verbesserte Finanzierungssituation ermöglicht Investitionen.
- Importe von Landmaschinen haben sich zuletzt vervielfacht.
- Aufbau von Wertschöpfungsketten im Agrarbereich in vollem Gang.
- Höherer Selbstversorgungsgrad und Exporte in Wachstumsregion Zentralasien bieten eine Perspektive.
- Regierung erhöht mit neuen Regeln Druck auf ausländische Lieferanten von Technik, um Lokalisierung zu stärken.
Kasachstan strebt eine höhere Eigenversorgung und mehr Exporte landwirtschaftlicher Erzeugnisse an. Dafür importiert das Land moderne Technik, um die Produktivität zu erhöhen.
Die Landwirtschaft hat in den vergangenen Jahren mehr Aufmerksamkeit von Seiten der Regierung genossen. Der Primärsektor soll nicht nur die Selbstversorgung mit Lebensmitteln sicherstellen, sondern auch zur Diversifizierung der Wirtschaft und der Exporte beitragen. Dafür fließt viel Geld in Form von Subventionen und zinsgünstigen Krediten. Mittel- bis langfristig strebt die Regierung den Aufbau von Clustern an, welche die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau bis hin zur intensiven Verarbeitung miteinschließen sollen.
Die Dynamik in der Landwirtschaft hat in den letzten Jahren für klingelnde Kassen bei ausländischen Anbietern von Maschinen, Ausrüstungen und anderen Zulieferungen gesorgt. Die Investitionsvorhaben dürften die Auftragslage auch in Zukunft stabil halten. Mit einem umfangreichen Engagement ausländischer Landwirte wird der kasachische Agrarsektor jedoch nicht rechnen können. Das für Ausländer weiterhin geltende Verbot, landwirtschaftliche Flächen zu erwerben oder zu pachten, verhindert als wesentliches Hemmnis einen regen Zustrom ausländischen Kapitals.
Verdoppelung der Agrarproduktion bis 2028 angepeilt
Im Jahr 2024 produzierte Kasachstan landwirtschaftliche Erzeugnisse im Wert von etwa 16,3 Milliarden US-Dollar (US$), so das kasachische Statistikamt. Der vom Landwirtschaftsministerium veröffentlichte Plan für die Entwicklung der Agrarindustrie im Zeitraum 2024 bis 2028 ist sehr ambitioniert. Er sieht vor, die Bruttoagrarproduktion in den nächsten Jahren auf über 33 Milliarden US$ zu verdoppeln. Dasselbe gilt für die Ausfuhren von Agrargütern und Lebensmitteln, die von 5 Milliarden auf 10 Milliarden US$ steigen sollen.
Um die Ziele zu erreichen, will das Ministerium viel Geld in die Hand nehmen: Fast 20 Milliarden US$ werden Landwirten in den nächsten Jahren in Form von zinsgünstigen Krediten bereitstehen, um die Frühjahrsfeld- und Erntearbeit vorzubereiten, Landmaschinen zu leasen und Investitionen zu tätigen. Neben Krediten sollen auch reichlich Subventionen fließen, bis 2028 könnten sich die jährlichen Zahlungen auf 1,7 Milliarden US$ ebenfalls verdoppeln. Ob Kasachstans Landwirtschaft den großen Sprung schafft, hängt nicht zuletzt auch von extremen Wetterereignissen, Währungsschwankungen und immer wiederkehrenden Handelsstreitigkeiten mit Russland ab.
Mit der Produktionssteigerung will die Regierung auch erwirken, dass das Land sich in mehreren Lebensmittelkategorien selbst versorgen kann. Eine hundertprozentige Selbstversorgungsquote strebt Kasachstan bis 2028 beispielsweise bei Äpfeln (2023: 85 Prozent), Wursterzeugnissen (63 Prozent), Käse und Quark (59 Prozent) sowie Geflügelfleisch (75 Prozent) an. Der Richtwert für Zucker (55 Prozent) ist 83 Prozent.
Cluster sollen zukünftig wichtige Rolle spielen
Für den Ausbau ist vor allem ein höheres Maß an Effizienz nötig, wofür unter anderem auf spezialisierte Agrarcluster gesetzt wird. So beginnt der chinesische Investor Dailan Hesheng Holding Group 2025 in der nördlichen Region Akmola mit dem Bau einer Anlage für die Verarbeitung von Weizen. Weitere Projekte zur Verarbeitung von Weizen sind im Gebiet Kostanay und der Hauptstadt Astana geplant.
Im warmen Süden gehen 2025 mehrere Gewächshauskomplexe an den Start, wo unter anderem Tomaten angebaut werden sollen. Für die auf 650 Hektar ausgelegte Anlage in Schymkent, die größte ihrer Art in Zentralasien, zeichnet sich das türkische Unternehmen Alarko Holding verantwortlich. Die russische Holding Eco-Kultura baut in der Region Turkestan an einem Gewächshauskomplex, der in Zukunft auf bis zu 500 Hektar erweitert werden könnte.
Importe von Landmaschinen haben sich zuletzt vervielfacht
Dass die Regierung so viel Geld aufwendet, um die Landwirtschaft zu unterstützen, ist nicht unumstritten. Experten kritisieren, dass die Subventionen nicht im Verhältnis zur Produktivitätssteigerung stehen. Tatsächlich ist die Arbeitsproduktivität in der kasachischen Landwirtschaft um ein Vielfaches niedriger als in Ländern mit vergleichbarem Klima, so das Ergebnis einer Analyse der Halyk Bank. Anbieter von Landmaschinen dürfte der Geldregen aber freuen.
So importierte Kasachstan 2023 Landtechnik im Wert von etwa 1,43 Milliarden US$, dreimal so viel wie im Vorjahr. Das größte Wachstum verzeichneten laut UN Comtrade Traktoren, Mähdrescher, Maschinen zur Reinigung und Sortierung von Saatgut, Getreide und Hülsenfrüchten und Maschinen für die Nahrungsmittelproduktion. Deutschland gehört in den meisten Kategorien zu den wichtigsten Lieferländern. Die Konkurrenz kommt aus China, Russland und anderen EU-Ländern. Änderungen bei Subventionsrichtlinien dürften die Importe in Zukunft aber dämpfen und der Lokalisierung einen Schub verpassen.
Umfangreiche staatliche Förderung für Landwirte
Den Erwerb von Landtechnik unterstützt die kasachische Regierung mit Subventionen von 15 bis 50 Prozent. Die Liste mit den aktuellen Fördersätzen ist auf der Seite des Justizministeriums einsehbar. Darüber hinaus winken Subventionen für Dünge- und Pflanzenschutzmittel oder den Einkauf von hochqualitativem Saatgut und Setzlingen. Landwirte können außerdem Dieselkraftstoff zu ermäßigten Preisen erwerben. Perspektivreiche Agrarprojekte sind mit Investitionszuschüssen von bis zu 25 Prozent der Kosten förderfähig.
Die Subventionen für den Kauf moderner Bewässerungstechnik wurden 2024 von 50 auf 80 Prozent angehoben. Damit reagiert Kasachstan auf Wasserknappheit in der Region, die durch den Ausbau der Landwirtschaft noch verschärft werden könnte. Der Primärsektor steht für etwa 60 Prozent des gesamten Wasserverbrauchs im Land. Ziel der Regierung ist es, dass bis 2030 auf der Hälfte der bewässerten Flächen wassersparende Technologie zum Einsatz kommt, gegenüber etwa 26 Prozent im Jahr 2024.
Zentrale Förderaktivitäten sind gebündelt bei Agrocredit (Schwerpunktе: zinsgünstige Kredite; Mikrokredite, Kreditgarantien, Versicherung) und KazAgroFinance (Leasing).
Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Landwirtschaft gefragt
Der stellvertretende kasachische Landwirtschaftsminister kündigte für 2025 und 2026 den verstärkten Einsatz von KI an, um Prozesse zu automatisieren und effizienter zu gestalten. So sollen Chat-Bots Subventionsanträge bearbeiten, KI-betriebene Drohnen zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden und die Bodenanalyse mittels satellitengestützter Geoanalyse vom Feld auf den Computer verlagert werden.
Mittelfristig will die Regierung durch den Einsatz von moderner Technik und KI die Ernteerträge um 10 bis 15 Prozent steigern und den Wasserverbrauch um bis zu 25 Prozent senken.
Branchenstruktur
Die Rolle des Agrarsektors für Kasachstans Wirtschaft hat sich in den letzten drei Jahrzehnten stark gewandelt. Noch Anfang der 1990er Jahre hatte er als einer der prägenden Wirtschaftszweige des jungen, unabhängigen Kasachstans einen Beitrag von etwa einem Drittel zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf sich vereinigt. In der Folgezeit nahm vor allem der Rohstoffsektor rasant an Bedeutung zu, weshalb zehn Jahre später nur noch rund 8 Prozent der Bruttowertschöpfung auf die Landwirtschaft entfielen.
Mittlerweile hat sich der Beitrag zum BIP auf 3,9 Prozent nochmals halbiert. Immerhin: Das Allzeittief von 3,8 Prozent im Jahr 2023 scheint damit überwunden. Im Jahr 2024 ist der Agrarsektor real um 13,7 Prozent gewachsen und erzielte damit das höchste Wachstum unter allen Wirtschaftsbereichen im Land. Für den Arbeitsmarkt ist die Landwirtschaft weiter ein wichtiger Faktor. Die Anzahl der Beschäftigten hat sich in den letzten Jahren bei etwa über einer Million eingependelt. Im Jahr 2024 entsprach das 11,2 Prozent aller Erwerbstätigen in Kasachstan.
Auch für einige Regionen spielt die Landwirtschaft eine überdurchschnittlich bedeutende Rolle: In sieben der insgesamt 17 Gebiete übertraf ihr Beitrag zum jeweiligen regionalen BIP 2023 die Marke von 10 Prozent. Am höchsten fiel er in den Gebieten Nordkasachstan und Turkestan mit 21,6 Prozent und 17,1 Prozent aus. Weitere wichtige Agrarregionen sind Schettisu im Südosten, Akmola im Zentrum und Schambyl im Süden des Landes.
Weizen dominiert als Getreidekultur
In der Pflanzenproduktion, auf die 2023 etwa 60 Prozent des wertmäßigen Ausstoßes der Landwirtschaft entfielen, dominiert der Anbau von Getreidekulturen. Auf ihr Konto gingen knapp 74 Prozent aller für den Ackerbau genutzten Flächen. Dabei überwiegt der Anbau von Weizen und Gerste. Für Ölsaaten, darunter vor allem Lein und Sonnenblumen, sowie Gemüse und Knollen wurden 12 Prozent und knapp 2 Prozent der Ackerflächen genutzt. Das Gros der für Ackerbau genutzten Flächen wird in Kasachstan durch größere Agrarunternehmen bewirtschaftet.
Private Hof- oder Nebenwirtschaften beschäftigen sich demgegenüber kaum mit Ackerbau. Als ihre Domäne gilt die Tierproduktion. Etwa 90 Prozent der Rinder, Schafe und Ziegen werden von Haushalten und kleinen Farmbetrieben gehalten. Größere Agrarunternehmen sind stark vertreten bei der Haltung von Hühnern und Schweinen, wo sie 2024 Anteile von 80 und 50 Prozent hatten.
Geschäftschancen in der Verarbeitung von Lebensmitteln
In den nächsten Jahren werden weitere Cluster in Schwerpunktbereichen etabliert. Große landwirtschaftliche Betriebe werden daher zunehmend an Bedeutung gewinnen. Da der Fokus auf Wertschöpfungsketten liegt, können sich ausländische Akteure als Lieferanten von Technik und Ausrüstungen sowie mit ihrem landwirtschaftlichen Know-how einbringen. Der Regierungsplan für die Lebensmittelindustrie im Zeitraum 2024 bis 2028 sieht vor, den Anteil der verarbeiteten Nahrungsmittel von 40 auf 70 Prozent zu erhöhen. Milch-, Getreide- und Fleischverarbeitung bieten das größte Potenzial.
Das haben auch internationale Investoren erkannt. Die ausländischen Direktinvestitionen in die Lebensmittelindustrie erreichten mit über einer halben Milliarde US$ im Jahr 2023 einen Rekordwert und übertrafen das Vorjahresergebnis fast um das Dreifache. Beim Anbau von Pflanzen und der Viehwirtschaft spielen Anleger aus dem Ausland hingegen keine Rolle, da sie kein Land erwerben können. Die jährlichen ausländischen Direktinvestitionen überstiegen in den vergangenen Jahren nie die Marke von 50 Millionen US$. Im Jahr 2023 betrug der Anteil der Branche an der verarbeitenden Industrie in Kasachstan 14,4 Prozent und hat noch Luft nach oben.
Produktivität in der Landwirtschaft ist noch sehr gering
Der durchschnittliche jährliche Verschleiß bei Landmaschinen liegt in Kasachstan bei 80 Prozent, die jährliche Erneuerung bei rund fünf Prozent. Verschiedene Studien, darunter von der Kazakh National Agrarian Research University, sehen das als einen der Hauptgründe für die geringe Produktivität in der kasachischen Landwirtschaft. Zwar hat sich diese laut Angaben der Regierung in den letzten fünf Jahren verdoppelt, doch sie beträgt weiterhin nur einen Bruchteil des Wertes anderer Agrarnationen. Experten empfehlen daher, jährlich zehn Prozent des Maschinenparks zu modernisieren. Finanzielle Anreize beim Kauf von Landmaschinen bereiten dafür den Boden.
Kasachstan bei Landtechnik auf Importe angewiesen
Trotz der Bestrebungen, die Versorgung der Agrarproduzenten mit verschiedenen Vorleistungen oder Ausrüstungen stärker als bisher eigenständig zu bestreiten, fielen die Importe zuletzt höher als je zuvor aus. Neben verschiedenen Landmaschinen und Zuchttieren wird häufig auch ausgewähltes Saatgut im Ausland beschafft. Bei Kali- und Phosphatdünger kann der Bedarf überwiegend selbst gedeckt werden. Stickstoffhaltiger Dünger wird zu über 50 Prozent importiert, vorwiegend aus Russland.
Laut dem staatlichen Thinktank Qazindustry bauen in Kasachstan mehr als 30 Unternehmen Landmaschinen aller Art. Um den Marktanteil heimischer Landtechnik zu stärken, hat die kasachische Regierung 2020 eine Entsorgungsabgabe für Landmaschinen eingeführt, die vor allem importierte Ausrüstung teurer macht. Beim Kauf von lokal gefertigten Maschinen wird der durch die Entsorgungsabgabe verursachte Preisaufschlag durch spezielle Kaufprämien, die nur für diese Maschinen gelten, ausgeglichen. Zudem wurden 2024 die Subventionsrichtlinien zugunsten von lokalen Produzenten verschärft.
Das und das aktive Werben der Regierung um ausländische Investoren zeigt Wirkung: Namhafte Branchenriesen montieren bereits Traktoren und Mähdrescher in Kasachstan, darunter das deutsche Unternehmen Claas. Im Lokalisierungszentrum Agromashholding in Qostanai wird zudem bald Ausrüstung der Marken John Deere und Amazone zusammengeschraubt. Der Lokalisierungsgrad soll schrittweise erhöht werden.
KASACHSTAN / STEUERRECHT: Kasachstan treibt die Novellierung des Steuerrechts voran
Das kasachische Unterhaus des Parlaments (Mazhilis) prüft weiterhin den Gesetzesentwurf zur Änderung der Steuergesetzgebung. Der angepasste Gesetzentwurf enthält die vom Ministerium der Finanzen im August 2024 vorgeschlagenen Maßnahmen zur Novellierung des kasachischen Steuerrechts.
Branchenspezifische Körperschaftssteuersätze werden eingeführt
Wie im ursprünglichen Entwurf vorgesehen, werden branchenspezifische Körperschaftssteuersätze für bestimmte Steuerzahler eingeführt:
- 25 Prozent für Banken und Glücksspielunternehmen;
- 10 Prozent für Unternehmen, die Finanzdienstleistungen erbringen;
- Für Bildung und Arzneimittelherstellung werden 5 Prozent und eine schrittweise Erhöhung auf 10 Prozent ab 2027 vorgeschlagen.
Der Steuersatz für landwirtschaftliche Produkte bleibt dagegen bei 3 Prozent.
Höhere Steuern für Besserverdienende
Natürliche Personen sind ebenfalls von Steueränderungen betroffen, wenn ihr jährliches Einkommen das 8.500-fache des monatlichen Berechnungsindexes (ca. 33.422.000 Tenge; ca. 57.416,79 Euro) übersteigt. Für sie soll eine Einkommensteuer in Höhe von 15 Prozent gelten. Darüber hinaus berät das Parlament über die Einführung eines progressiven Steuersatzes.
Update vom 2. Mai 2025: In zweiter Lesung hat das Unterhaus des Parlaments die Einführung eines progressiven Steuersatzes beschlossen.
- Für Gebietsansässige mit einem Einkommen unter 8.500 des monatlichen Berechnungsindexes gilt ein Steuersatz von 10 Prozent.
- Für Gebietsfremde gilt ein Steuersatz von 10 Prozent bei einem Einkommen bis zu 600.000 des monatlichen Berechnungsindex und von 17 Prozent bei einem Einkommen, das diesen Betrag übersteigt.
Zudem wird vorgeschlagen, eine so genannte „Luxus“-Steuer auf teure Immobilien, Autos, Schiffe, Flugzeuge sowie Alkohol- und Tabakprodukte einzuführen. Auch Einkünfte unter anderem aus Staatsanleihen sollen besteuert werden. Das Parlament erwartet dadurch zusätzliche Einnahmen in Höhe von 4 bis 5 Billionen Tenge.
Umsatzsteuer wird erhöht
Unternehmen müssen sich auf eine Erhöhung der Umsatzsteuer einstellen, wenn der Entwurf endgültig verabschiedet wird: Die allgemeine Umsatzsteuer soll von derzeit 12 Prozent auf 16 Prozent angehoben werden.
Für kostenpflichtige medizinische Dienstleistungen ist ein Steuersatz von 10 Prozent vorgesehen. Gleichzeitig sollen Anbieter von Basismedikamenten und Grundnahrungsmitteln sowie von neu erschienen Büchern von der Umsatzsteuer befreit werden.
Darüber hinaus wird der Schwellenwert für umsatzsteuerliche Registrierung von 78,6 Millionen Tenge auf 40 Millionen Tenge gesenkt. Die Herabsetzung des Schwellenwertes schafft eine breitere Steuerbasis und der Staat rechnet mit höheren Staatseinnahmen. Zudem entsprechen niedrige Schwellenwerte für die Umsatzsteuerregistrierung der internationalen Praxis. Durch die Anpassung an internationalen Standards kann Kasachstan die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Ländern verbessern.
KIRGISISTAN / AUSSENHANDEL: Exportpartner in der Landwirtschaft gesucht
Der Bundesverband des Deutschen Exporthandels (BDEx) steht aktuell in engem Austausch mit der Botschaft der Kirgisischen Republik in Berlin. Im Zuge dieser Beziehungen ist der Verband gebeten worden, potenzielle Partner unter deutschen Unternehmen zu identifizieren, die Interesse am Import kirgisischer Produkte haben.
Gesucht werden insbesondere Abnehmer aus den Bereichen Textilien und Baumwolle, Seltenerdmetalle sowie landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Walnüsse, Aprikosen, Kartoffeln und weitere Agrarprodukte. Viele kirgisische Unternehmen haben in jüngster Zeit eine Biozertifizierung erhalten und sind nun bereit für den Export nach Deutschland.
Bei Interesse stellt der BDEx gerne eine Übersicht potenzieller kirgisischer Partnerunternehmen sowie weiterführende Informationen zur Verfügung.
Kontakt: Alexander Hoeckle, alexander.hoeckle@bdex.de Vanessa Kassem. vanessa.kassem@bdex.de
KROATIEN / MARKT: Kroatien bleibt attraktiver Standort für deutsche Unternehmen
Aktuelle AHK-Umfrage: Fachkräftemangel wird als größtes Geschäftsrisiko genannt.
Die Konjunkturumfrage der AHK Kroatien (Deutsch-Kroatische Industrie- und Handelskammer), deren Ergebnisse Anfang Mai 2025 veröffentlicht wurden, zeichnet ein positives Bild: Fast 90 Prozent der befragten Mitgliedsunternehmen bewerten die Wirtschaftslage im Land als gut oder befriedigend. Mehr als drei Viertel erwarten 2026 ein ähnliches oder stärkeres Wirtschaftswachstum. Immerhin 86 Prozent würden erneut in Kroatien investieren.
Das Land punktet bei deutschen Investoren vor allem mit seiner EU-Mitgliedschaft, der günstigen geografischen Lage und stabilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Diese Faktoren stärken die Wettbewerbsfähigkeit und unterstreichen die Rolle Kroatiens als attraktiver und verlässlicher Wirtschaftsstandort in der Region.
Der anhaltende Fachkräftemangel gilt auch im dritten Jahr in Folge als größtes wirtschaftliches Risiko. Die Unternehmen setzen verstärkt auf interne Fortbildungsprogramme und den Ausbau digitaler Prozesse, um das Fehlen von Arbeitskräften zu kompensieren. Von der kroatischen Regierung fordern die Befragten den Abbau bürokratischer Hürden und eine effizientere öffentliche Verwaltung.
Die AHK Kroatien führt ihre Konjunkturumfrage jährlich durch. Im Jahr 2025 nahmen mehr als 100 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen teil. Die Ergebnisse spiegeln sowohl das Vertrauen der deutschen Wirtschaft in Kroatien wider als auch den Reformbedarf, um das Investitionsklima weiter zu verbessern.
POLEN / HANDELSRECHT: Unternehmen müssen eine e-Zustellung ermöglichen
Die elektronische Zustellung hat die gleiche Wirkung wie ein Einschreiben mit Rückschein. Die Unternehmen sind dazu verpflichtet, eine Adresse für e-Zustellungen einzurichten.
Eine elektronische Adresse für die elektronischen Zustellungen betrifft alle Unternehmen, die im Gewerberegister (CEIDG) und im polnischen Unternehmensregister (KRS) eingetragen sind. Neben handelsrechtlichen Gesellschaften (z.B. Aktiengesellschaften) müssen auch andere im Unternehmerregister eingetragene Einrichtungen, z.B. Genossenschaften oder Stiftungen, eine Adresse für e-Zustellungen haben.
Folgende Fristen, die vom Datum der Registrierung des Unternehmens in CEIDG oder KRS abhängen, sind zu beachten:
- Unternehmen, die ihre Tätigkeit ab dem 1. Januar 2025 in CEIDG oder KRS eintragen lassen, werden bei der Eintragung ein Postfach für e-Zustellungen einrichten müssen;
- Unternehmen, die ihre Tätigkeit vor dem 1. Januar 2025 im CEIDG registriert haben, müssen ab dem 1. Oktober 2026 eine Adresse für die elektronische Zustellung haben;
- Unternehmen, die ihre Tätigkeit vor dem 1. Januar 2025 im KRS angemeldet haben, müssen seit dem 1. April 2025 eine Adresse für die elektronische Zustellung haben.
Bis Oktober 2029 werden alle öffentlichen Einrichtungen, lokalen Behörden sowie Gerichte, Gerichtsvollzieher den amtlichen Schriftverkehr über e-Zustellungen abwickeln müssen. Ab diesem Jahr benutzen die öffentliche Verwaltung, Krankenkassen und regionale Gebietskörperschaften die e-Zustellung.
Ein Postfach für die e-Zustellungen kann online unter Biznes.gov.pl eingerichtet werden.
SLOWENIEN / TECHNISCHE NORMEN: Neue Qualifikation der Wirtschaftszweige
Slowenien hat nun auch die nationalen Normen zur Klassifizierung von Wirtschaftszweigen dem europäischen Binnenmarkt angepasst.
Die neue Fassung der Standardsystematik der Wirtschaftszweige (SKD 2025; Standard Classification of Activities 2005) ist in Kraft getreten und löst die derzeit gültige SKD 2008 ab. SKD sind verbindliche nationale Normen, die zur Bestimmung der Tätigkeiten und zur Klassifizierung von Unternehmen für die Erfassung in diversen Datenbanken verwendet werden.
Die nationalen SKD werden durch die europäische „Statistische Systematik der Wirtschaftszweige“, abgekürzt NACE, bestimmt. Der Begriff NACE leitet sich von dem französischen Titel ab: Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ab.
In Übereinstimmung mit der überarbeiteten Fassung der NACE Rev. 2.1 und den nationalen Bedürfnissen hat das Statistische Amt der Republik Slowenien eine neue nationale Fassung der SKD 2025 erstellt. Sie wurde durch die Verordnung über die Standardklassifikation der Tätigkeit (Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 27/2024 vom 29.3.2024, Seite 2153) übernommen.
Die neue Einstufung bringt eine Reihe von Änderungen und Ergänzungen mit sich: Die meisten von ihnen sind in den Bereichen Handel sowie Informations- und Kommunikationsaktivitäten zu finden. Die wichtigsten Unterschiede zwischen der neuen und der aktuellen Klassifizierung sind im Dokument Unterschiede zwischen SKD 2008 und SKD 2025 beschrieben.
UKRAINE / WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT: Ukraine intensiviert Maßnahmen gegen Korruption
Durch die Änderungen der Straf- und Steuergesetze wird die Bekämpfung und Vorbeugung von Korruption im internationalen Geschäftsverkehr gestärkt.
Mit gleich zwei Änderungsgesetzen setzt die ukrainische Regierung die Empfehlungen der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) zur Bekämpfung von Korruption im internationalen Geschäftsverkehr um.
Empfehlungen der OECD
OECD hat mehrere Empfehlungen an die Ukraine zur Korruptionsbekämpfung ausgesprochen. Es wurde unter anderem empfohlen, die Anti-Korruptionspolitik zu stärken. Die Ukraine legte mit der Antikorruptionsstrategie vom 20. Juni 2022 den Grundstein für die Umsetzung der Empfehlungen.
Die Änderungsgesetze Nr. 4111-IX und Nr. 4112-IX setzen unter anderem die Anforderung um, die Präventionsmaßnahmen zu verbessern und eine effektive Durchsetzung sicherzustellen. Des Weiteren wird die Anforderung nach einer Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit zur Bekämpfung grenzüberschreitender Korruption erfüllt.
Im Fokus stehen dabei steuerlichen Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung sowie die Einführung von strafrechtlicher Verantwortlichkeit von Unternehmen für Korruptionsdelikte.
Korruptionsstraftaten im Fokus
Mit dem Änderungsgesetz Nr. 4111-IX wird eine strafrechtliche Verantwortung für Unternehmen für Korruptionsdelikte eingeführt, die in ausländischen Rechtsordnungen begangen werden. Zu den strafbaren Handlungen zählen unter anderem:
- missbräuchliche Einflussnahme;
- Angebot oder Zusicherung von Bestechungsgeldern;
- Geldwäsche.
Das Gesetz über Maßnahmen zur Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr ist am 26. Dezember 2024 in Kraft getreten.
Handeln von Vertretern wird zugerechnet
Für die Haftung ist es nicht erforderlich, dass ein Unternehmen selbständig handelt. Es genügt, wenn ein Bevollmächtigter im Interesse des Unternehmens handelt und die Bestechungshandlung an einen ausländischen Amtsträger richtet. Das Unternehmen kann entweder gemeinsam mit einem verdächtigen Vertreter oder gesondert in einem eigenen Verfahren zur Verantwortung gezogen werden.
Geldstrafen und vorübergehende Geschäftsbeschränkungen drohen
Gerichte können verantwortliche Unternehmen mit Geldstrafen von bis zu drei Millionen US-Dollar sanktionieren oder ihre Vermögenswerte beschlagnahmen. Darüber hinaus können auch nichtfinanzielle Maßnahmen verhängt werden, wie etwa eine vorübergehende Einschränkung der Geschäftstätigkeiten, die den Ausschluss von öffentlichen Aufträgen oder von internationalen Projektfinanzierungen beinhaltet.
Außerdem ist es Gerichten möglich, gegen verdächtigte Unternehmen, einstweilige Maßnahmen zu ergreifen in Form von Verboten oder Beschränkungen, zum Beispiel: Verbot, rechtliche Dokumente zu ändern und Vermögenswerte zu veräußern oder wesentliche Transaktionen zu beschränken.
Steuerliche Maßnahmen im Korruptionskampf
Das Gesetz Nr. 4112-IX über steuerliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr trat zum 25. März 2025 in Kraft.
Der Zweck des Gesetzes besteht darin, einen Mechanismus zur Identifizierung mutmaßlicher illegaler Vorteile einzuführen, bevor es zu einem Gerichtsverfahren kommt. Des Weiteren soll es Voraussetzungen zur Prävention von Steuerstraftaten schaffen, die Amtsträgern – sowohl ausländischen als auch inländischen – rechtswidrige Vorteile verschaffen.
Keine steuerlichen Vorteile bei Verdacht auf Bestechung
Steuerpflichtige Unternehmen können keine steuerlichen Vorteile geltend machen, wenn sie Ausgaben getätigt haben, die im Zusammenhang mit der Gewährung unzulässiger Vorteile oder Bestechungsgeldern an Amtsträger stehen. Diese Ausgaben können nicht mehr als Betriebsausgaben angegeben werden, um die steuerliche Bemessungsgrundlage zu mindern. Infolgedessen wird die Bemessungsgrundlage um den Betrag der Betriebsausgaben nachträglich erhöht.
Gleichzeitig haben die Steuerpflichtigen die Möglichkeit, ihre Steuerschulden selbständig zu korrigieren, wenn konkrete Anhaltspunkte für die Gewährung von unrechtmäßigen Vorteilen bestehen.
Ferner müssen Steuerpflichtige mit einer außerplanmäßigen Steuerprüfung rechnen, wenn ein Gerichtsurteil die Bestechung eines Amtsträgers festgestellt hat.
Zusätzliche Befugnisse für Steuerbehörden
Zudem werden die Aufgaben des staatlichen Steuerdienstes erweitert. Der Steuerdienst ist verpflichtet, sowohl das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) als auch die Steuerpflichtigen über alle bei der Prüfungen entdeckten Umstände zu informieren, die auf die Gewährung eines rechtswidrigen Vorteils hinweisen könnten.
Das Ministerium der Finanzen (Міністерство Фінансів України) und das NABU werden einen Leitfaden mit Hinweisen auf mögliche Bestechungshandlungen erstellen. Diese Liste dient der Orientierung für den staatlichen Steuerdienst und für die Steuerpflichtigen, um Handlungen oder Situationen zu identifizieren, die auf rechtswidrige Vorteile hinweisen.
UNGARN / INVESTITIONSKLIMA: Ungarn erleichtert Zugang zu F&E-Fördermitteln
Forschungsinvestitionen sind in einigen Landesteilen bereits ab 2 Millionen Euro Investitionsvolumen förderfähig. Auch die erforderliche Beschäftigtenzahl wurde auf 50 gesenkt.
Ungarns Regierung veröffentlichte Ende April 2025 neue Leitlinien zur Investitionsförderung. Darin werden die Mindestanforderungen an Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) deutlich gesenkt. István Joó, Chef der ungarischen Agentur für Investitionsförderung (HIPA), erklärte anlässlich der Bekanntgabe, die Regierung wolle so die Innovationsfähigkeit der ungarischen Industrie stärken.
Die wichtigste Änderung ist, dass für staatliche Direktzuschüsse in bestimmten Regionen die Mindestinvestitionsschwelle auf 2 Millionen Euro gesenkt wird. Auch die Personalanforderung für F&E-Förderung wird von 100 auf 50 Beschäftigte reduziert. Zudem können sich Unternehmen mit Ausbildungskosten ab 250.000 Euro und 25 Mitarbeitenden für Weiterbildungsinitiativen qualifizieren, ohne dass zusätzliche Investitionen nötig sind.
Von der Neuregelung profitieren elf Landkreise in Südungarn, die im Landesvergleich unterdurchschnittlich entwickelt sind. Bislang lag die Fördergrenze dort bei 3 Millionen Euro. In anderen Regionen wurde diese Schwelle beibehalten. In industriestarken Städten wie Győr oder Debrecen müssen mindestens 10 Millionen Euro investiert werden. Budapest ist von der Förderung ausgeschlossen.
Ungarn setzt seit Jahren auf aktive Industriepolitik und fördert Produktionsansiedlungen großzügig. Die Entscheidung, jetzt die Förderung von Forschungsinvestitionen zu erleichtern, erfolgt vor dem Hintergrund einer rückläufigen Industrieproduktion und handelspolitischer Unsicherheiten.
UNGARN / MASCHINENBAU: Ungarns Maschinenbauer kämpfen mit schwacher Konjunktur
Die Ausrüstungsinvestitionen ungarischer Unternehmen sind rückläufig. Die schwache Auslandsnachfrage macht der exportabhängigen Maschinenbaubranche zu schaffen.
Ausblick des Maschinenbaus in Ungarn
- Die Nachfrage der wichtigsten inländischen Abnehmer von Maschinen und Anlagen sinkt, eine Trendwende ist vorerst nicht in Sicht.
- Deutschland ist der mit Abstand größte Exportmarkt der Branche, die Krise der deutschen Automobilindustrie ist deutlich zu spüren.
- Neue Infrastrukturprojekte und staatliche Förderprogramme könnten die Inlandsnachfrage nach neuer Ausrüstung mittelfristig stimulieren.
Markttrends
In Ungarns Wirtschaft läuft es seit einiger Zeit nicht rund. Das Wachstum für 2024 blieb mit 0,6 Prozent deutlich unter den Erwartungen. Auch für 2025 wurden die staatlichen Wachstumsprognosen deutlich nach unten korrigiert. Die exportorientierte ungarische Wirtschaft leidet unter der Krise der deutschen Automobilindustrie. Und der von den USA angezettelte Handelskonflikt sorgt für zusätzliche Unsicherheit.
Gerade bei den wichtigsten inländischen Abnehmern von Maschinen und Anlagen ist die konjunkturelle Lage alles andere als gut: 2024 schrumpfte die Industrieleistung um 4,3 Prozent, die Produktion im Fahrzeugbau – dem bedeutendsten Industriezweig Ungarns – ging um 9,0 Prozent zurück. Auch die Bauwirtschaft und der Agrarsektor arbeiten im Krisenmodus. Das beeinflusst die Investitionsentscheidungen der Unternehmen.
In der Krise wird weniger Ausrüstung beschafft
Ungarische Betriebe investierten 2023 laut Herbstprognose der EU-Kommission 10,5 Prozent weniger in neue Ausrüstungen. Für 2024 wurde ein Rückgang in gleicher Höhe prognostiziert, 2025 soll wieder ein leichtes Plus von 2,5 Prozent bringen. Doch der inländische Markt spielt für ungarische Maschinenbauer nur eine untergeordnete Rolle: 81,3 Prozent des Gesamtumsatzes stammte 2024 aus Exporterlösen.
Die Produktionsleistung des ungarischen Maschinenbaus ging 2024 um 7,2 Prozent zurück. Die Gesamtumsätze lagen um knapp 10 Prozent im Minus. Für die exportorientierte Branche ist die schwache Nachfrage in wesentlichen Zielmärkten das größte Problem: Die Exporte nach Deutschland, dem wichtigsten Markt für ungarische Maschinen und Anlagen, brachen im Jahr 2024 um immerhin 8,4 Prozent ein.
Bau- und Industrieprojekte versprechen mehr Nachfrage
Angesichts schwieriger Rahmenbedingungen ist unsicher, ob Ungarn 2025 die erhoffte konjunkturelle Wende gelingt. Positive Signale kommen aus dem Bausektor, dort sind größere Infrastrukturprojekte geplant – etwa Tiefbauprojekte, die Spezialmaschinen erforderlich machen. Mehr Mittel könnten auch im Agrarsektor fließen: Branchenvertreter erwarten neue staatliche Ausschreibungen für moderne Ausrüstungen, Präzisionsmaschinen und den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI).
Die Regierung rechnet außerdem mit weiterhin starken ausländischen Industrieinvestitionen. Zuletzt siedelten sich große chinesische Unternehmen in Ungarn an, die ihre Maschinen und Anlagen in der Regel gleich mitbringen. Andere ausländische Investoren kündigten 2024 Produktionserweiterungen und -modernisierungen an. Investitionsprojekte werden von der ungarischen Regierung mit Zuschüssen und steuerlichen Vergünstigungen gefördert.
KMU erhalten staatliche Investitionszuschüsse
Für KMU gibt es seit Ende 2024 ebenfalls ein Förderprogramm für Anlageinvestitionen. Das Demján-Sándor-Programm stellt für kleine und mittlere Betriebe zinsgünstige Finanzierungsmöglichkeiten und nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse bereit. Schwerpunktmäßig wird der Kauf von Maschinen, Geräten und Automatisierungslösungen gefördert. Allein das Kapitalprogramm von Demján-Sándor ist mit umgerechnet rund 245 Millionen Euro ausgestattet, die maximale Förderhöhe liegt bei knapp 0,5 Millionen Euro.
Einen Automatisierungsschub könnten die neuen Werke von BMW und BYD auslösen. In beiden Produktionsstätten sollen tausende Roboter zum Einsatz kommen. Produktionsstart ist dieses Jahr. Branchenexperten erwarten, dass es zu einem Spill-Over-Effekt auf die Zulieferer kommen könnte. Das würde auch neue Geschäftschancen für Ausrüster eröffnen: Laut International Robotics Federation (IFR, 2023) lag die Roboterdichte in der ungarischen Industrie zuletzt deutlich unter EU-Durchschnitt, hinter Slowenien, Tschechien und der Slowakei.
Branchenstruktur und Rahmenbedingungen
Die ungarische Maschinenbauindustrie umfasste 2023 rund 2.200 Unternehmen. Davon waren mehr als 1.600 Betriebe Kleinstunternehmen mit maximal neun Mitarbeitenden. Die 43 größten Hersteller mit mehr als 250 Mitarbeitenden generierten 2023 knapp 70 Prozent des gesamten Branchenumsatzes. Automobilbauer und Automobilzulieferer sind die wichtigsten Abnehmer ungarischer Maschinen.
Größere Maschinenbauer in ausländischer Hand
Die kleineren inländischen Unternehmen produzieren nur selten komplette Maschinen oder Anlagen, sie sind vorrangig auf Maschinenteile spezialisiert. Bei den großen Unternehmen handelt es sich vor allem um ausländische Hersteller. Dazu gehören etwa Kuka Hungaria (Robotertechnik), Grundfos (Spezialpumpen), Claas und McHale (Landmaschinen), Siemens (Turbinenschaufeln) oder Körber Hungária, das seit 1994 Maschinen und Ausrüstungen für die Tabakindustrie herstellt.
Ein aufblühender Industriestandort ist das ostungarische Debrecen. Dort haben namhafte Maschinenbauer ihren Sitz, die weniger stark auf die Kfz-Industrie ausgerichtet sind. Krones gilt als Initialzünder der Entwicklung. Der deutsche Hersteller für Abfüllanlagen nahm sein Werk 2019 in Betrieb und beschäftigt über 760 Mitarbeiter. Das größte ausländische Werk von Harro Höfliger ist ebenfalls in Debrecen. Der Spezialist für Verpackungsanlagen von Medizin- und Pharmaprodukten konnte 2024 einen Rekordumsatz erzielen, eine neue Werkhalle für knapp 15 Millionen Euro ist im Bau.
Csaba Juhász, Geschäftsführer von Harro Höfliger Ungarn, rät Anlagen- und Maschinenbauern, ihre Produktion zu diversifizieren. Wachstumsbranchen wie die Pharma- und Halbleiterindustrie, den Energiesektor oder die Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie seien vielversprechende Zielmärkte. Ungarn sei für Maschinenbauer nach wie vor ein hochinteressanter Standort. Das Land punkte mit Kostenvorteilen und Industriekompetenz
USBEKISTAN / ZOLL: Usbekistan führt Halal-Zertifizierungsverfahren ein
Usbekistan regelt künftig per Verordnung, wie Produkte und Dienstleistungen zertifiziert werden, die den Halal-Anforderungen entsprechen.
Usbekistan hat eine Verordnung eingeführt, die das Verfahren zur Halal-Zertifizierung von Produkten und Dienstleistungen regelt. Daher sind seit dem 1. Mai 2025 Produkte und Dienstleistungen, die nach den SMIIC-Anforderungen zertifiziert sind, mit dem Halal-Zeichen zu kennzeichnen. Das neue Gesetz sieht anschließend eine regelmäßige Bewertung dieser Produkte und Dienstleistungen vor.
Außerdem ist geplant, neue Zertifizierungsstellen für Produkte und Dienstleistungen gemäß den Halal-Anforderungen zu schaffen. Bei der Zertifizierung und der Festlegung der Anforderungen ist das Institut für Normen und Metrologie islamischer Länder (SMIIC) maßgeblich beteiligt. Dabei wird jedoch den auf internationaler Ebene offiziell anerkannten Normen Vorrang eingeräumt.
Der Antragsteller stellt einen Antrag in elektronischer Form bei der Zertifizierungsstelle. Die Zertifizierungsstelle prüft ihn innerhalb von drei Arbeitstagen. Die jeweilige Bewertung erfolgt am Ort der Herstellung der Produkte oder der Erbringung der Dienstleistungen.
Wenn während der Bewertung Zweifel an der Zusammensetzung der hergestellten oder verwendeten Produkte bestehen, werden unter Beteiligung des Antragstellers Produktproben entnommen und in ein akkreditiertes Prüflabor, das in den behördlichen Dokumenten im Bereich der technischen Regulierung und der Halal-Anforderungen festgelegt wurde, gesendet.
WESTBALKAN / PROJEKTE: Westbalkan erweitert und modernisiert seine Schieneninfrastruktur
Die Westbalkanländer bauen mithilfe der EU ihre Transportkorridore aus. Im Fokus stehen Schienenwege. Geschäftschancen haben Anbieter von Baudienstleistungen und Baumaschinen.
Der Westbalkan ist von Deutschland aus per Zug nicht erreichbar. Das Eisenbahnnetz ist seit dem Ende der Balkankriege in den 90er Jahren kaum entwickelt und unterfinanziert. Weniger als die Hälfte der Streckenabschnitte sind elektrifiziert. Die Signaltechnik ist veraltet. Ein Großteil der Gleise kann nur mit maximal 60 Kilometer pro Stunde befahren werden. Zum Umladen von Schiene auf Straße werden mehr multimodale Güterterminals benötigt.
EU unterstützt beim Ausbau des Schienennetzes
Um die Volkswirtschaften der Region enger mit der EU zu verzahnen, die Konnektivität untereinander zu erhöhen und eine Einbindung in das transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-V) zu erreichen, wollen die sechs Länder ihre Schieneninfrastruktur erweitern und modernisieren.
Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRE) und das Western Balkan Investment Framework (WBIF) der EU finanzieren den Ausbau des Schienennetzes über Darlehen und Zuschüsse. Die Europäische Eisenbahnagentur (ERA) arbeitet bei der Steigerung der Konnektivität in der Region bis 2026 mit der Organisation Transport Community mit Sitz in Belgrad zusammen.
Für deutsche Unternehmen ergeben sich bei folgenden Gewerken Geschäftschancen:
- Beton- Bewehrungs-, Entwässerungsarbeiten;
- Tunnelbauarbeiten;
- Stahlbauarbeiten bei Eisenbahnbrücken;
- Ingenieurs- und Beratungsdienstleistungen;
- Baumaschinen
Zu den Entwicklungen in den Ländern des Westbalkans im Einzelnen: Westbalkan erweitert und modernisiert seine Schieneninfrastruktur | Branchen | Westbalkan | Projekte im Schienenverkehr
Naher Osten und mittlerer Osten
SAUDI-ARABIEN / REGISTERRECHT: Neue Regelungen über wirtschaftliche Berechtigte in Saudi-Arabien
Das saudische Handelsministerium gründet ein Transparenzregister zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Für Unternehmen bedeutet das neue Mitteilungspflichten.
Am 3. April 2025 hat das saudi-arabische Handelsministerium mit Beschluss Nr. 235 neue Regelungen über wirtschaftliche Berechtigte in Kraft gesetzt. Kern dieser Rechtsetzung ist ein neues Transparenzregister innerhalb des Ministeriums für Handel.
Dieses Register führt die wirtschaftlichen Berechtigten sämtlicher Unternehmen im Sinne des saudi-arabischen Gesetzes für Handelsgesellschaften. Ausgenommen vom Anwendungsbereich sind Aktiengesellschaften, die an der saudi-arabischen Börse (Tadawul) gelistet sind – ebenso öffentlich-rechtliche Unternehmen sowie Unternehmen in Liquidation.
Begriff des wirtschaftlichen Berechtigten folgt internationalen Standards
In Anlehnung an internationale Standards handelt es sich bei wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des neuen Beschlusses um eine natürliche Person, die:
- unmittelbar oder mittelbar 25 Prozent der Unternehmensanteile hält oder;
- unmittelbar oder mittelbar 25 Prozent der Stimmrechte auf sich vereinigt oder;
- unmittelbar oder mittelbar die Geschäftsführung, die Mehrheit der Vorstandsmitglieder oder die Vorsitzende ein- oder absetzen kann oder;
- in der Lage ist, die operativen Geschäfte oder Entscheidungen des Unternehmens zu beeinflussen oder
- Bevollmächtigte einer juristischen Person ist, die eine der oben genannten Kriterien erfüllt.
Einzelheiten zur Mitteilungspflicht stehen noch nicht fest
Unternehmen, die sich im Prozess der Gründung befinden, müssen Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten machen. Dieselbe Verpflichtung trifft bereits existierende Unternehmen. Damit das Transparenzregister stets die aktuellen Verhältnisse wiedergibt, müssen Unternehmen spätestens 15 Tage nachdem eine für das Register relevante Änderung stattgefunden hat, dem Handelsministerium eine entsprechende Mitteilung machen. Dazu müssen sie einmal im Jahr bestätigen, dass die Registerangaben (noch) richtig sind.
Oben genannte Mitteilungspflichten sind Bußgeldbewehrt. Deren Einzelheiten stehen allerdings noch aus. Insbesondere muss das Handelsministerium noch die Tiefe der zu dokumentierenden Informationen bestimmen sowie das Verfahren festlegen.
Mit dem neuen Regelwerk beabsichtigt das Königreich die Standards der Financial Action Task Force (FATF) umzusetzen. Im Jahr 1989 auf Initiative der G 7 gegründet, bekämpft die FATF Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Zu diesem Zweck entwickelt die internationale Organisation Standards für nationale Behörden, damit letztere effektiv gegen illegale Finanzströme vorgehen können.
TÜRKEI / CHEMIE: Türkische Chemie kämpft mit Gegenwind
Wirtschaftliche Risiken, hohe Kosten und neue EU-Vorgaben stellen die türkische Chemie vor Herausforderungen – einige Segmente zeigen dennoch Stärke.
Ausblick der chemischen Industrie in der Türkei
- Inlandsnachfrage könnte durch eine Abkühlung der türkischen Wirtschaft gebremst werden.
- Schwache Konjunkturentwicklung in wichtigen Absatzmärkten würde Exporte dämpfen.
- Anhaltende Schwäche der Lira begünstigt Exporte, verteuert jedoch die Importe von Vorprodukten.
Zu den Markttrends und der Branchenstruktur im Einzelnen: Chemische Industrie Türkei
TÜRKEI / KONSUMGÜTER: Neue Kennzeichnungsvorschrift für Konsumgüter
Die Regelung zielt insbesondere auf Bestandteile von Schweinen ab.
Konsumgüter, die Bestandteile tierischen Ursprungs enthalten, müssen ab dem 9. Juni 2025 entsprechend gekennzeichnet sein. Erforderlich sind Angaben zur Tierart, von der die Bestandteile stammen, also zum Beispiel von Schweinen. Die Kennzeichnung muss in türkischer Sprache an dem Produkt selbst, an der Verpackung oder mit einem Beipackzettel erfolgen. Die Kennzeichnung muss leicht lesbar und darf nicht irreführend sein. Sie muss vor der Übergabe der Ware für den Käufer erkennbar sein. Im Fall von Onlinehandel muss bereits in der Warenbeschreibung auf die tierischen Bestandteile hingewiesen werden.
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE / EINREISE: Neues Visum ohne Sponsor für die Vereinigten Arabischen Emirate
Der Wegfall des Sponsors für Geschäftsleute und Tourist:innen wird die Einreise in die Vereinigten Arabischen Emirate erleichtern.
Das neue Visum gilt für Aufenthalte von 90 Tagen und kann auf maximal 180 Tage verlängert werden. Es berechtigt die Inhaber zur mehrfachen Einreise. Geschäftsleute und Touristen können es online beantragen – unter anderem beim General Directorate for Identity and Foreigners Affairs – Dubai. Für umgerechnet circa 167 Euro (700 VAE – Dirham) erhalten Antragsteller das neue Visum innerhalb einer Bearbeitungsdauer von fünf bis sieben Werktagen. Außerdem müssen die Antragsteller eine Kaution in Höhe von umgerechnet circa 478 Euro (2.000 VAE – Dirham) hinterlegen. Das Erfordernis der Kaution tritt an die Stelle des Erfordernisses, einen Sponsor zu stellen. Ein Sponsor ist eine emiratische Person (natürlich und juristisch), die für bestimmte Forderungen eines Ausländers einsteht, die während dessen Aufenthalt in den Vereinigten Arabischen Emiraten entstehen mögen.
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE / FREIHANDEL: Dubai weicht Grenze zwischen Freihandelszone und Staatsgebiet auf
Eine neue Resolution erleichtert es Unternehmen in Freihandelszonen, Waren und Dienstleistungen im Staatsgebiet von Dubai anzubieten. Einstweilen unklar ist, in welchen Branchen.
Die Regierung von Dubai hat mit der Resolution Nummer 11/2025 (Resolution) beschlossen, dass Unternehmen in Freihandelszonen unter bestimmten Voraussetzungen auch auf dem Staatsgebiet von Dubai Geschäfte machen dürfen.
Neue Verordnung ermöglicht Dubai-Engagement auf drei Arten
Art. 4 der Resolution ist die zentrale Vorschrift. Danach erteilt das Department of Economy and Tourism des Emirats Dubai (DET) Unternehmen in Freihandelszonen:
- die Erlaubnis zur Gründung einer Zweigniederlassung auf dem Staatsgebiet von Dubai;
- die Erlaubnis zur Gründung einer Zweigniederlassung, die sich aus der Freihandelszone in Dubai betätigt, oder;
- die Genehmigung, spezifische Aktivitäten auf dem Staatsgebiet in Dubai auszuüben.
Bei der Erlaubnis zur Gründung einer Zweigniederlassung auf dem Staatsgebiet geht es um eine physische Präsenz in Dubai (Art. 5 Ziffer 5 der Resolution), dagegen bedarf es für die Erlaubnis zur Gründung einer Zweigniederlassung, die sich aus der Freihandelszone betätigt, keiner physischen Präsenz in Dubai, dasselbe gilt für die Genehmigung, spezifische Aktivitäten in Dubai auszuüben.
Hohe bürokratische Anforderung für Erlaubnisse und Genehmigung nach Art. 4
Für ihr künftiges Dubai-Geschäft im Sinne der Resolution müssen Unternehmen in Freihandelszonen jedoch einen bürokratischen Preis zahlen. Denn in sämtlichen Fällen erteilt das DET die Erlaubnis beziehungsweise die Genehmigung erst dann, wenn dem Antrag eine Zustimmung der zuständigen Freihandelszonenbehörde beigefügt wird, gegebenenfalls bedarf es auch der Zustimmung weiterer öffentlicher Stellen, die mit der Aufsicht des betreffenden Gewerbes in Dubai betraut sind (Art. 5 A, 6 A und 7 – jeweils Ziffern 2 und 3, Ziffern 3 und 4 sowie Ziffern 3 und 4 der Resolution).
Da im Falle der Errichtung einer Zweigniederlassung auf dem Staatsgebiet von Dubai eine physische Präsenz entsteht, müssen hier die gesellschaftsrechtlichen Voraussetzungen zur Gründung einer Zweigniederlassung erfüllt sein.
In sämtlichen Fällen müssen Freihandelszonenunternehmen, die sich auf dem Staatsgebiet von Dubai betätigen wollen, gemäß Art. 3 der Resolution sowohl die Bundesgesetze der Vereinigten Arabischen Emirate als auch die lokalen Gesetze des Emirates Dubai beachten.
Unternehmen müssen kein neues Personal für Geschäfte in Dubai einstellen
In den Fällen der Erlaubnis zur Gründung einer Zweigniederlassung handelt es sich bei Letzteren um keine selbständigen juristischen Personen. Das stellen die Art. 5 B und 6 B der Resolution klar. Gleichwohl führen diese Zweigniederlassungen eine von der Muttergesellschaft getrennte Finanzbuchhaltung. Diese Trennung der Finanzverwaltung gilt nicht für das Personal – so gestattet Art. 8 der Resolution Unternehmen mit einer Erlaubnis oder Genehmigung nach Art. 4 der Resolution, ihre vorhandene Belegschaft auch für ihre Aktivitäten in Dubai einzusetzen.
Möglichkeit der Betätigung in Dubai nur für gelistete Gewerbe
Spätestens Anfang Juni 2025 wird die DET eine Liste derjenigen Gewerbe veröffentlichen, für die eine Erlaubnis oder Genehmigung nach Art. 4 der Resolution erhältlich sein wird (Art. 9 der Resolution). Mit anderen Worten wird es einen beschränkten Bereich wirtschaftlicher Aktivitäten geben, innerhalb dessen sich Unternehmen aus Freihandelszonen in Dubai betätigen dürfen.
Diese Einschränkungen des Betätigungsradius in Verbindung mit dem bürokratischen Aufwand zur Erlangung einer Erlaubnis oder Genehmigung nach Art. 4 der Resolution wirft die Frage auf, warum Investoren nicht gleich ein Unternehmen in Dubai gründen sollten.
Freihandelszonen bieten Vorteile gegenüber dem Staatsgebiet
Die Antwort dürfte in den regulatorischen Vorteilen liegen, die Freihandelszonen gegenüber dem Staatsgebiet (noch) bieten. Freihandelszonen sind geografisch abgegrenzte Flächen innerhalb eines Emirates und zeichnen sich durch ihre vergleichsweisen liberalen Gesetze aus. Insbesondere bei ausländischen Investoren sind Freihandelszonen beliebt, da sie dort von je her 100 Prozent der Anteile einer Handelsgesellschaft halten dürfen. Bis zur Reform des Gesellschaftsrechts Ende 2020 galt die Regel, dass Ausländer maximal 49 Prozent der Unternehmensanteile halten, der Rest war emiratischen Staatsangehörigen vorbehalten. Mittlerweile existieren auf dem Staatsgebiet für ausländische Investoren nur noch für Gewerbe mit strategischer Relevanz Beteiligungsgrenzen.
Freihandelszonen werden zollrechtlich wie das Ausland behandelt
Was nach wie vor für Freihandelszonen spricht, ist die gegebenenfalls geringere steuerliche Belastung – so locken viele Freihandelszonen mit Befreiungen von der Körperschaftsteuer. Ebenso benötigen Investoren in Freihandelszonen keine physische Präsenz, ein virtuelles Büro reicht. Dazu ist der Gründungsprozess schneller als auf dem Staatsgebiet und zugunsten von ausländischen Investoren auf Englisch. Schließlich zahlen Unternehmen in Freihandelszonen etwa auf importierte Vorprodukte keine Zölle.
Eine Erlaubnis oder Genehmigung nach Art. 4 der Resolution lohnt sich auch deshalb, weil ohne sie Warenlieferungen aus Freihandelszonen in das Staatsgebiet wie Warenimporte behandelt werden. Das bedeutet, dass der Warenempfänger im Staatsgebiet eine Importlizenz benötigt und der jeweilige Zollsatz fällig wird. Auch der Export von Dienstleistungen aus der Freihandelszone in das Staatsgebiet würde durch eine Erlaubnis oder Genehmigung erleichtert, insbesondere die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen.
Welt
WELT / DATENSCHUTZ: Datenschutz weltweit: Globale Standards und Datentransfer
Der Datenschutz kennt längst keine Landesgrenzen mehr. Weltweit entstehen neue Regelungen und internationale Datentransfers rücken in den Fokus.
Weltweit uneinheitliches Datenschutzniveau
In einer zunehmend digitalisierten Welt ist der Schutz personenbezogener Daten ein zentrales Thema. Viele Unternehmen agieren weltweit und personenbezogene Daten werden über Ländergrenzen hinweg verarbeitet. Das Datenschutzniveau weltweit ist jedoch sehr uneinheitlich ausgeprägt: Während einige Länder umfassende Datenschutzgesetze erlassen haben, fehlen in anderen grundlegende Schutzvorschriften für personenbezogene Daten.
Die Europäische Union hat sich in diesem Rahmen mit der im Mai 2018 in Kraft getretenen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) als ein Vorreiter des Datenschutzes positioniert und neue Standards etabliert. Da das Datenschutzniveau weltweit sehr unterschiedlich ist, stellt für europäische Unternehmen der grenzüberschreitende Datentransfer in sogenannte Drittländer oftmals eine große Herausforderung dar. Die DSGVO erlaubt die Übermittlung personenbezogener Daten in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) nur unter bestimmten Bedingungen. Ziel ist es, sicherzustellen, dass das Datenschutzniveau auch im Drittland dem europäischen Standard entspricht.
Datenübermittlung in Drittländer
Die DSGVO enthält in Kapitel 5 (Art. 44 – 50) Regelungen zum Datentransfer in Drittländer beziehungsweise Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums. In Anlehnung an Art. 44 ff. DSGVO dürfen personenbezogene Daten nur dann in Drittländer übermittelt werden, wenn ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist. Grundsätzlich stehen hierfür drei rechtliche Mechanismen zur Verfügung.
Der erste ist der Angemessenheitsbeschluss nach Art. 45 DSGVO: Die Europäische Kommission kann feststellen, dass ein Drittland ein angemessenes Datenschutzniveau bietet. Liegt ein solcher Beschluss vor, dürfen Daten ohne weitere Genehmigungen übermittelt werden.
Zweitens können Unternehmen auf Standarddatenschutzklauseln nach Art. 46 DSGVO zurückgreifen. Diese von der EU-Kommission vorgegebenen Vertragsmuster verpflichten den Empfänger im Drittland zur Einhaltung eines angemessenen Datenschutzniveaus.
Drittens erlaubt Art. 49 DSGVO in Ausnahmefällen eine Datenübermittlung, etwa wenn die betroffene Person ausdrücklich eingewilligt hat oder die Übermittlung zur Vertragserfüllung notwendig ist. Diese Ausnahmeregelungen sind jedoch eng auszulegen und nur für gelegentliche Übermittlungen gedacht.
Die USA als Sonderfall
Die USA stehen seit Jahren im Fokus diverser Datenschutzdebatten. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zwei Abkommen zur Datenübermittlung – Safe Harbor (2015) und Privacy Shield (2020) – wegen unzureichenden Datenschutzstandards für nichtig erklärt. Hauptkritikpunkt war die weitreichende Zugriffsmöglichkeit der US-Behörden auf personenbezogene Daten.
Nach dem Scheitern der Vorgängerregelungen hat die Europäische Kommission im Juli 2023 das neue EU-U.S. Data Privacy Framework (oftmals auch als Privacy Shield 2.0 bezeichnet) im Rahmen eines Angemessenheitsbeschlusses im Sinne des Art. 45 DSGVO angenommen und damit bestätigt, dass personenbezogene Daten aus der EU in die USA übermittelt werden dürfen, wenn sie an Organisationen gehen, die sich diesem Rahmen unterwerfen.
Zentraler Bestandteil des neuen Abkommens ist ein zweistufiger Rechtsschutzmechanismus, der europäische Betroffene vor unrechtmäßigen Datenzugriffen durch US-Behörden schützen soll.
- Auf der ersten Stufe können EU-Staatsangehörige eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde ihres Heimatstaates einreichen, die diese dann an einen Civil Liberties Protection Officer (CLPO) des US Intelligence Coordination Center (Nationales Koordinationszentrum für Nachrichtendienste) weiterleitet. Der CLPO prüft, ob ein Datenschutzverstoß vorliegt und kann verbindliche Abhilfemaßnahmen treffen.
- Auf der zweiten Stufe besteht für EU-Bürger:innen die Möglichkeit, die Entscheidung des CLPO von einem Data Protection Review Court (Datenschutzgericht) überprüfen zu lassen. Der Data Protection Review Court ist zwar nicht Teil der Judikative, soll aber innerhalb der Exekutive unabhängig agieren. EU-Bürger können am Verfahren nicht teilnehmen, sondern werden von einem vom Datenschutzgericht bestellten Rechtsanwalt vertreten. Im Rahmen der Überprüfung der Entscheidung des CLPO ist das Gericht befugt, entsprechende Informationen von den US-Geheimdiensten einzuholen. Nach Abschluss des gerichtlichen Überprüfungsverfahrens wird die Entscheidung dem Beschwerdeführer mitgeteilt.
Wohin steuert der weltweite Datenschutz?
Der globale Datenschutz entwickelt sich dynamisch weiter. Was lange Zeit als europäisches Spezialthema galt, gewinnt zunehmend weltweit an Bedeutung. Immer mehr Staaten erkennen den Schutz personenbezogener Daten als zentrales Element von Rechtsstaatlichkeit und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit an. Schon jetzt befinden sich in Dutzenden Ländern Gesetzvorhaben in Planung, um den Schutz personenbezogener Daten gesetzlich zu verankern. Der Datenschutz wird mithin global verbindlicher für Unternehmen. Daher müssen Unternehmen, die in Zukunft auf den weltweiten Märkten handeln möchten, auch datenschutzrechtlich gut aufgestellt sein.
Besonders herausfordernd ist der Umgang mit internationalen Datentransfers. Einschränkungen bei der Übermittlung von Daten ins Ausland können gegeben sein, wenn das Zielland kein angemessenes Datenschutzniveau garantiert. Unternehmen müssen daher prüfen, welche rechtlichen Grundlagen für grenzüberschreitende Datenübertragung jeweils gelten.
WELT / INVESTITIONEN: Global Gateway – EU investiert in Infrastruktur weltweit
Global Gateway ist die Konnektivitätsinitiative der Europäischen Union. Die EU will damit Schwellen- und Entwicklungsländern helfen, ihre Infrastruktur nachhaltig auszubauen.
Im Rahmen von Global Gateway will die EU 300 Milliarden Euro für nachhaltige Infrastrukturprojekte rund um die Welt zwischen 2021 und 2027 mobilisieren. Gefördert werden Projekte in den fünf Bereichen Energie und Klima, Transport, Digitales, Gesundheit, Bildung und Forschung.
Der weltweite Bedarf an Infrastrukturinvestitionen ist groß. Am sichtbarsten wird dieser Bedarf zurzeit von Chinas neuer Seidenstraße bedient. Chinesische Projekte stehen jedoch wegen Mängeln bei Umwelt- und Sozialstandards sowie Überschuldung der Seidenstraßenländer schon länger in der Kritik. Mit Global Gateway schafft die EU nun ein betont nachhaltiges Angebot. In unserem Fact Sheet stellen wir Ihnen die EU-Initiative vor: Welche Branchen und Weltregionen stehen im Mittelpunkt? Wie sollen die Investitionsziele erreicht werden? Welche Rolle spielen Unternehmen bei Global Gateway? Und welche Chancen und Herausforderungen gibt es?
Zum Factsheet: Global Gateway – EU investiert in Infrastruktur weltweit | Fact Sheet
WELT / VERTRAGSRECHT: Strafzölle in internationalen Lieferverträgen
Manchmal ändern sich Verhältnisse so sehr, dass internationale Lieferverträge nicht mehr wirtschaftlich oder durchführbar sind. Was sagt das Recht dazu?
Die neuen US-Importzölle für Waren verändern den internationalen Handel grundlegend. Sie können erhebliche Auswirkungen auf Kostenstrukturen und Lieferketten haben. Häufig wird die Frage sein, wer in der Lieferkette letztendlich für diese Zölle bezahlt, oder wer den Schaden aus einer möglichen Unterbrechung einer Lieferkette trägt.
Verträge als wichtigste Rechtsquelle
Antworten auf die aufgeworfenen Fragen werden sich häufig in den Verträgen finden, die Unternehmen mit ihren Geschäftspartnern abgeschlossen haben. Dort sollte geregelt sein, wer die Einfuhrzölle zahlt und ob – und auf welche Weise – zusätzliche Zölle weitergegeben werden können. Möglicherweise sind eine Aussetzung, Neuverhandlung oder sogar Beendigung des Vertrages vorgesehen, wenn die Zölle die Erfüllung unwirtschaftlich machen.
Wer zahlt die Zölle?
Grundsätzlich liegt die rechtliche Verpflichtung zur Exportfreimachung beim eingetragenen Importeur. Wer dies ist, hängt von der vertraglichen Vereinbarung ab. Häufig werden insofern Incoterms®-Regeln vereinbart. Diese enthalten viele Möglichkeiten der Aufgabenverteilung. Zwischen „Delivered Duty Paid“ (DDP – Verantwortung der Verkäuferseite) und „Ex Works“ (EXW – Verantwortung des Käufers) gibt es verschiedene weitere Standardklauseln, die verschiedene Mittelwege anbieten. Details hierzu bietet GTAI in dem Bericht über den Einfluss des Zoll- und Außenwirtschaftsrechts auf die Vertragsgestaltung.
Preisklauseln
Viele Verträge enthalten Bestimmungen, die Preisanpassungen ermöglichen, wenn sich relevante Kostenfaktoren drastisch ändern. Je nach konkreter Formulierung können diese genutzt werden, wenn beispielsweise keine klare Zuordnung der Verantwortung für die Verzollung gegeben ist. Auch wenn sie selbst keine klare Regelung enthalten, können sie doch vielleicht als Anknüpfungspunkt für Verhandlungen dienen.
Höhere Gewalt
Viele Verträge, gerade im angelsächsischen Rechtskreis, enthalten sogenannte force majeure-Klauseln. Solche Klauseln gibt es in vielen Ausprägungen und Varianten. Allerdings: Allein höhere Kosten für die Lieferung von Waren aufgrund von Zöllen reichen in der Regel nicht aus, um höhere Gewalt geltend zu machen. Die meisten Rechtsordnungen betrachten einen erhöhten Aufwand allein nicht als Rechtfertigung für eine allgemeine Aussetzung von Verpflichtungen, es sei denn, die vertragliche Klausel über höhere Gewalt oder eine andere Bestimmung deckt ausdrücklich „wirtschaftliche Härten“, „extreme Preisschwankungen“ oder sogar „Zölle“ ab.
Ist eine force majeure-Klausel anwendbar, könnte sich eine Vertragspartei auf sie berufen, um ihre Verpflichtungen zu modifizieren oder sogar auszusetzen. Dies würde verhindern, dass sie für Nichterfüllung haftbar gemacht wird und möglicherweise Schadensersatz zahlen muss.
Sonstige Härtefallklauseln
Viele Handelsverträge sehen die Möglichkeit der Änderung/Neuverhandlung/Kündigung des Vertrags auf der Grundlage einer (finanziellen oder allgemeineren) „Härtefallklausel“ vor. Einige Verträge beinhalten zum Beispiel, dass bedeutende Änderungen des Rechtsrahmens eine Neuverhandlung oder – in einigen Fällen – sogar eine Kündigung ermöglichen, wenn neue gesetzliche oder behördliche Anforderungen das wirtschaftliche oder rechtliche Umfeld drastisch verändern.
Bestehen solche Bestimmungen nicht, können die Parteien eine einvernehmliche Kündigung oder eine Änderung des Vertrags aushandeln, insbesondere wenn keine der beiden Seiten von einem sich verschlechternden oder unrentablen Geschäft profitiert.
Was regeln die Gesetze?
Zunächst muss ermittelt werden, welches Recht gilt. Deutsche Gerichte ermitteln das anwendbare Recht nach den Vorschriften der Rom-I-Verordnung (VO (EG) 593/2008). Bei Kaufverträgen, für die keine ausdrückliche Rechtswahl getroffen wurde, wird man häufig bei der Anwendung des UN-Kaufrechts landen. Nur wenn dieses ausdrücklich ausgeschlossen wurde, kann deutsches Recht anwendbar sein.
UN-Kaufrecht
Nach dem UN-Kaufrecht (CISG) entschuldigt Art. 79 CISG die Nichterfüllung, wenn der Betroffene nachweisen kann, dass sie auf einem nicht von ihm zu vertretenden Hindernis beruhte, das er vernünftigerweise nicht vorhersehen, vermeiden oder überwinden konnte. Die Gerichte legen die Hürden jedoch in der Regel hoch. Ob neue Zölle in der heutigen politischen Situation wirklich nicht vorhersehbar sind, ist eine komplexe Frage, die oft von den Absichten der Parteien bei Vertragsabschluss abhängt. Prinzipiell dürfte die Unvorhersehbarkeit der US-Zölle jedoch sehr schwierig zu begründen sein.
Deutsches Recht
Nach § 313 BGB kann eine Vertragspartei Anspruch auf Anpassung des Vertrages haben, wenn
- sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind,
- nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert haben und
- die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen hätten, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten,
und einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. Das Problem der – im Zweifel fehlenden – Unvorhersehbarkeit besteht auch hier.
- 313 Abs. 1 BGB sieht primär einen Anspruch auf inhaltliche Anpassung des Vertrages vor. Nur wenn eine Anpassung nicht möglich oder dem anderen Vertragspartner nicht zumutbar ist, gibt § 313 BGB das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, beziehungsweise den Vertrag durch Kündigung zu beenden.
Kündigung als Gestaltungsmittel?
Angesichts aktueller Herausforderungen kann der Gedanke aufkommen, den problematisch gewordenen Vertrag einfach zu kündigen oder die Erfüllung zu verweigern. Vom Grundsatz her können Dauerschuldverhältnisse auch ohne besondere Begründung gekündigt werden, häufig mit einer vereinbarten Frist. Auch insofern empfiehlt sich zuerst ein Blick in den Vertrag. Eine nicht vertraglich vorgesehene oder eine fristlose Kündigung, oder sogar eine Erfüllungsverweigerung sollten auf keinen Fall ohne vorherige, ausführliche rechtliche Beratung vorgenommen werden. Sie werden wahrscheinlich zu Erfüllungs- und / oder Schadensersatzansprüchen der anderen Seite führen.
© Copyright 2025 – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieses Internetangebots, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei der GTAI (Germany Trade & Invest, Hauptsitz Berlin, Friedrichstraße 60, 10117 Berlin). Bitte fragen Sie uns, falls Sie die Inhalte dieses Internetangebotes verwenden möchten.
Wer gegen das Urheberrecht verstößt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert), macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).
Der BDEx erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Inhalte dienen der reinen Information und stellen insbesondere keine Rechtsberatungsdienstleistung dar.
